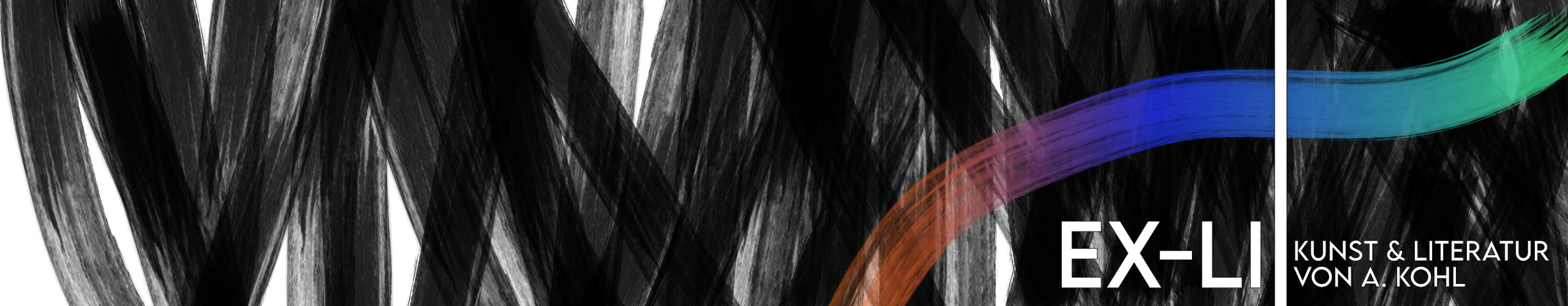Kapitel 57 – Der Hinterhalt
Kapitel 58 – Das Wiedersehen
Kapitel 59 – Spezialkapitel: Gaaras Geschichte und der Krieg vor über 4000 Jahren
Kapitel 60 – Die Konfrontation
Kapitel 61 – Verlieren
Kapitel 62 – Der Kompass
Kapitel 63 – Der Albtraum
Kapitel 57 – Der Hinterhalt
Der Sandsturm verlor immer mehr an Intensität. Die Hitze nahm ab, jedoch war an manchen Stellen der Sand noch so aufgeheizt, dass Kioku die Hitze wie Stacheln wahrnahm, die ständig gegen ihre Haut stachen.
Bei jedem Schritt krampften ihre Muskeln zusammen, weil ihr es so schwerfiel, durch den weichen Sand zu laufen. Es strengte ihren Körper extrem an. Dazu kam, dass ihr Kopf immer noch so unfassbar wehtat, dass sie sich nicht wirklich konzentrieren konnte. Diese Kopfschmerzen schienen sich in letzter Zeit häufig zu wiederholen. Sie selbst empfand das als sehr merkwürdig, weil sie früher kaum oder nur sehr selten über Kopfschmerzen zu klagen hatte. Als sie so darüber nachdachte, vermutete sie, dass es schlicht und einfach an der Anstrengung in der letzten Zeit lag. Da würde sich jede Person schnell einmal über Kopfschmerzen beschweren.
Vor ihr lief Anon, der immer wieder zu ihr zurückblickte, um zu prüfen, ob alles in Ordnung war. Dabei hielt er sich selbst seinen Brustkorb, der offensichtlich stark schmerzte.
Er war der Mann, den sie nie wieder allein lassen wollte. Was bedeuteten die Worte, die sie ihm so mutig gesagt hatte, bevor sie Jiro-Khale verlassen hatten? Es fühlte sich so an, als hätte sie ihm gerade die Liebe gestanden. Obwohl sie die Worte „Ich liebe dich“ nicht gesagt hatte, war es, als wären es genau diese Worte gewesen. Sie empfand es als merkwürdig, dass in der Zeit, an die sie sich seit ihrer Amnesie erinnern konnte, noch kein einziges Mal darüber nachgedacht hatte, diese Worte überhaupt zu irgendwem zu sagen. Der Satz „Ich brauche dich“, den sie ihm stattdessen gesagt hatte, war von stärkerer Bedeutung. Kioku hatte Anon schon in so vielen Situationen gebraucht; damit meinte sie nicht nur das eine Mal auf dem Luftschiff, als er es und sie gerettet hatte. Allein auch jemanden in ihrem Alter um sich zu haben – dabei wusste sie ja nicht einmal wirklich, wie alt sie war -, bedeutete schon eine Menge für sie.
Oben auf einer Sanddüne blieb Anon kurz stehen, kniete sich in den Sand und winkte Kioku zu sich.
„Die Spuren werden immer schwächer; der Wind verweht die Sandkörner und man kann ihre Schritte kaum mehr nachverfolgen. Ich schätze aber, dass sie in Richtung des Gebirges gegangen ist“, deutete Anon die wenigen Überbleibsel an Spuren im Sand. „Lass uns dahin gehen. Wenn sie vorhat, jemanden dort zu treffen, wäre das ein angemessener Treffpunkt.“
Als er sich wieder aufrichtete, verzerrte er sein Gesicht vor Schmerzen. Sofort kam Kioku näher, legte besorgt ihre Hände auf seine Schultern und fragte, ob alles in Ordnung war. Sie machte sich um seinen Zustand unfassbare Sorgen.
„Alles in Ordnung“, log Anon und ging weiter.
Kioku seufzte und ließ sich nicht zu viel Zeit, ihm zu folgen.
Sie suchten diese Frau und Kioku hoffte, dass sie nicht nur sie, sondern auch das Schwert wiederfinden würden. Und dann? Bisher hatte sie sich über das Danach keine Gedanken gemacht. Wäre Anon stark genug, die Frau zu überwältigen? Konnten sie die Frau durch einen Hinterhalt überraschen und ihr das Schwert wegnehmen, ohne dass sie es merkte? Vielleicht hatte sich Anon schon einen Plan ausgedacht, wie sie die Person überwältigen konnten.
Aber was passierte dann? Wenn sie die Frau gefunden und das Schwert zurückgeholt hatten? Auch darüber hatte sich Kioku bisher noch keine Gedanken gemacht. Auch nicht, als sie mit Anon losgegangen war, um nach Takeru und Alayna zu suchen. Was wäre passiert, hätten sie die Geschwister gefunden? Sie zweifelte daran, dass sich Takeru hätte überreden lassen, einfach zum Hotel zurückzugehen. Es hatte auch kein Danach gegeben, als sie mit den beiden losgezogen war, um ihren Vater zu finden. Was wäre passiert, wenn sie ihn gefunden hätten? Wären die Kinder mit ihm einfach nach Hause zurückgekehrt und sie wäre wieder allein gewesen?
Und niemals dachte sie darüber nach, was geschah, wenn sie ihr altes Ich wiederfand. Der Moment, nach dem sie sich so lange sehnte, herauszufinden wer sie war, hatte eine finstere Kehrseite.
Für einen Moment, als sie auf der nächsten Sanddüne zum Halt kam und die Stadt schon weit hinter ihr lag, betrachtete sie die Ferne der Wüste, die zu ihrer Rechten lag. Angezündet von der sich dem Horizont neigenden Sonne, erstrahlten die welligen Sandberge der Wüste in einem tiefen Rot. Irgendwo in dieser endlos scheinenden Weite versteckte sich die Antwort auf ihre dringendste Frage. Für einen Bruchteil eines Augenblicks schien dort in der Ferne jemand zu stehen, der aussah wie sie und ihr zuwinkte. Ihr altes Ich vielleicht? Sie schien nach ihr zu rufen, jedoch war kein Geräusch zu hören. Ihre Beine wollten in diese Richtung, doch sie hielt sich selbst zurück. Dann versank die Figur im Sand wie eine schwindende Fata Morgana – die letzte, die es an diesem Tag zu sehen gab. Kiokus Blick wandte sich wieder zu Anon, der etwas an Abstand zu ihr gewonnen hatte. Es war noch nicht Zeit, nach ihrem alten Ich zu suchen und das war vielleicht auch gut so, sprach Kioku zu sich selbst. Im Moment war sie glücklich, obwohl die bevorstehende Gefahr unfassbare Angst in ihr hervorquellen ließ. Jetzt musste sie für Anon und ihre Freunde da sein.
Stille begleitete die beiden, als sie sich den zu einem Berg anhäufenden Felsformationen näherten, wo Anon die Frau vermutete.
Anon stieg die verschiedenen Felsplatten und Plateaus hinauf und half Kioku beim Klettern. Dabei bemerkte sie, dass er nicht mehr so viel Kraft hatte. Der letzte Kampf hatte ihn wohl mehr erschöpft, als sie zunächst angenommen hatte. Anon tat jedoch sein Bestes, es sich nicht anmerken zu lassen. Kioku las ihn aber wie ein offenes Buch und versuchte, sich so, wenig wie es nur ging, helfen zu lassen.
An einer Stelle machte Anon Halt und ging auf die Knie. Er berührte eine Stelle mit seiner Hand und stellte fest, dass es dort etwas feucht war.
„Sie war hier“, stellte er fest und sah Kioku bestimmt an. „Es scheint noch frisch zu sein, also kann sie nicht mehr weit sein.“
„Wie stellen wir das an, Anon?“, fragte sie nach. „Sind wir zwei wirklich in der Verfassung, noch einmal gegen sie zu kämpfen?“
Sie war so besorgt, dass Anon etwas Schlimmes passieren könnte, dass sie diese Angst nicht in ihrem Gesicht verstecken konnte. Anon schien das zu spüren und zu sehen. Als Kioku den Blick erwidert bekam, blickte sie schnell nach links und rechts, um so zu tun, als würde sie sich umsehen.
„Wir brauchen einen Hinterhalt.“
„Das habe ich mir schon gedacht“, erklärte sich Kioku. „Meinst du, wir können uns heranschleichen und du stiehlst das Schwert vorsichtig mit deinen Bändern?“
„Das ist tatsächlich eine gute Möglichkeit“, bemerkte Anon, der offensichtlich noch nicht darüber nachgedacht hatte, wie er es anstellen sollte. „Das Problem ist nur, wenn sie das Schwert nah an ihrem Körper trägt. Was machen wir dann?“
„Meinst du, ich kann sie ablenken?“
„Auf keinen Fall!“, wurde Anon nun etwas lauter, sprach danach aber wieder leiser. „Das kommt gar nicht in Frage, nicht nur, weil sie dann bemerkt, dass ich in der Nähe sein werde, sondern auch, weil sie dich in kurzer Zeit einfach ausknocken kann.“
„Dann werde ich einfach schneller sein als sie. Dann ist das doch kein Problem. Du schnappst dir das Schwert und bevor sie sieht, was passiert ist, sind wir wieder weg.“
„Dann rennen wir den Berg hinunter durch den Sand zurück in die Stadt? Sie wird uns schneller einholen, als wir wollen. Das kommt alles auf keinen Fall in Frage“, antwortete Anon kühl. Seine Schlussfolgerungen machten schon Sinn, das musste sich Kioku eingestehen.
„Wir müssen uns schnell entscheiden“, drängte Anon. „Wir verlieren sonst die Spur.“
Er stand auf und bewegte sich in die Richtung, in der er Nafsu Percintaan vermutete. „Ich werde ihr das Schwert mit meinen Bändern stehlen. Und jetzt sollten wir still sein.“
Ihr Bauch fing an, aufgeregt zu kribbeln. Sie war so angespannt und hoffte, dass Anons engstirniger Plan funktionierte. In diesem Moment bereute sie es, dass sie sich in der Stadt keine Hilfe geholt hatten. Jetzt war die Situation nicht mehr zu ändern.
Die beiden stiegen kleinere Plateaus hinauf und hinab, quetschen sich zwischen Felsbrocken hindurch, die den Weg versperrten und Kioku fiel es relativ schnell auf, wie offensichtlich die Spuren waren, die Nafsu für die beiden hinterlassen hatte. Hier war ein feuchter Fleck auf dem Boden, da waren Steine verschoben, dort ein dürres Ästchen, das sich aus einer Felsspalte quetschte, abgebrochen. Anon schien die Fährten zu lesen, wie ein junger Pfadfinder und freute sich über jeden neuen Hinweis. Kioku waren diese Signale aber zu offensichtlich. Irgendetwas konnte daran nicht stimmen, traute sich aber nicht, etwas zu sagen. Ihr blieb nur übrig zu hoffen, dass es sich um unabsichtlich hinterlassene Spuren handelte.
Nach einer kurzen Weile führte ein schmaler Pfad auf eine sandige Ebene, die ringsum mit verschieden großen Felsbrocken umringt war. Nur an einer Stelle befand sich eine Lücke und Anon entschied, nachzuschauen, was man durch diese Lücke, die fast zwei Meter breit war, sehen konnte. Kioku folgte ihm.
Als sie sich der Lücke näherten, packte Anon in einem Sekundenbruchteil Kioku an der Schulter und drückte sie nach unten. Beide legten sich blitzschnell auf den Bauch und näherten sich vorsichtig krabbelnd der Kante der Ebene.
Kioku wollte erschreckt fragen, was los war, doch Anon signalisierte ihr mit einem Finger vor seinem Mund, dass sie ganz leise sein sollte. Als sie über die Kante hinweg hinabblickte, entdeckte sie auf einer weiteren Ebene ein kleines Feuer brennen. Das Lagerfeuer befand sich ein paar Schritte von einem Höhleneingang entfernt. Ein geheimer Unterschlupf vielleicht? Kioku schätzte, dass sich dieser Platz um die fünf bis acht Meter unterhalb ihrer Ebene befinden musste. Dann tippte ihr Anon auf die Schulter und deutete auf den Eingang der Höhle, in deren Halbschatten sie das Schwert an die Felswand gelehnt stehen sah.
Anon sagte nichts, sondern streckte seinen Arm aus und ließ eines seiner Bänder hinab, das sich um die Felsbrocken tänzelte wie eine Schlange. Kiokus Anspannung wurde nun intensiver und sie traute sich kaum, auszuatmen, aus Angst, dass man sie hören konnte. Aber warum machte das Anon so langsam? Was, wenn Nafsu aus der Höhle heraustrat und sie entdeckte? Dann wären sie aufgeschmissen.
Während sie beobachtete, wie sich das Band Anons weiter nach unten bewegte und sich jede Sekunde wie eine Minute anfühlte, blieb ihr ein Schluck merkwürdig schmerzend im Hals hängen.
Das war zu einfach.
Es war alles viel zu einfach. Das Lagerfeuer vor der Höhle, das Schwert, das unbeaufsichtigt vor dem Eingang der Höhle stand und die merkwürdige Stille, die das alles begleitete, waren Anzeichen, dass es viel zu einfach ging.
Dann blickte sie Anon an, konnte ihm zunächst nichts sagen, da ihr der Atem wegblieb. Er lag dort neben ihr im Dreck. Seine Augenbrauen berührten sich fast, weil er seine Augen vor Konzentration zusammenkniff. Das sonst so freundliche Gesicht wirkte durch die vielen Falten nun sehr angestrengt. Man sah ihm an, dass er nur noch wenig Kraft in sich hatte und mit seinen Schmerzen zu kämpfen hatte. Sein linker Arm zitterte leicht. Er versuchte, mit jedem Zentimeter, den sich das Band dem Schwert näherte, so schnell zu sein, wie er konnte, ohne aufzufallen.
Dann endlich nahm Kioku all ihre Kraft zusammen, um Anon ihre Befürchtungen mitzuteilen: „Anon, ich glaube wir sind in einen Hinterha…“
Der Schatten, der sich hinter den beiden erhob, verpasste mit dem stumpfen Ende des Speeres Anon einen Schlag in den seitlichen Oberkörper, als er sich reflexartig aufrichtete, um sich der Gefahr zuzuwenden. Anon krümmte sich vor Schmerz und nun richtete sich Kioku auf, um Nafsu zu konfrontieren, die sich von hinten angeschlichen hatte. Während sich ihr erster Blick auf Anon richtete, der sich zur Seite wälzte, um sich die schmerzende Stelle seines Oberkörpers festzuhalten, blieb ihr der Atem für einen Moment weg. Reflexartig begab sie sich in eine verteidigende Haltung, weil sie zu spüren glaubte, wie der pochende Schmerz Anon lähmte.
„Wen haben wir denn da, Aoko und Anon“, begrüßte Nafsu die beiden, während sie mit einem schnellen Schlag Kioku ein Bein wegzog. Dadurch verlor Kioku das Gleichgewicht und stolperte einige Schritte rückwärts. Unter ihrem rechten Fuß brach etwas vom Boden weg und bevor sie überhaupt verarbeiten konnte, mit welchem Namen sie gerade angesprochen worden war, befand sie sich im freien Fall.
Alles passierte so schnell, dass sie nur noch sah, wie sich Anon hinter sie her stürzte.
Wie ein Blitz, der in einen hochgelegenen Punkt einschlägt, schoss Kioku ein Bild vor ihre Augen. Ein grauer Himmel und ein menschlich wirkender Schatten, der ihr in ihrem freien Fall folgte. Dieses Bild hatte sie schon so oft gesehen, hatte es aber nicht deuten können. Es verging keine Sekunde, als sie eine andere Klippe erkannte und tief in ihrem Inneren spürte, dass auf dieses Bild nur sie umspülende Schwärze folgen sollte. Sie war schon einmal von einer Klippe gestürzt, da war sie sich so sicher, wie noch nie zuvor. Ihr war so etwas schon einmal passiert.
Doch dann verblich der Anblick, das nunmehr wie ein verblassendes Bild aus der Ferne kaum mehr zu erkennen war. Die Realität zwang sie wieder zu spüren, in welcher Situation sie sich befand. Der freie Fall kitzelte nicht nur in ihrer Magengegend, sondern sorgte auch für Übelkeit in diesem Moment. Dann entdeckte sie wieder, dass Anon ihr hinterher gesprungen war. Schnell wickelten sich seine Bänder um ihren Körper und formten ausschweifende Bögen um ihn herum. Dieses merkwürdige Konstrukt, das aussah wie ein Ball aus Streben, sollte sie beschützen, sodass der Aufprall auf dem Boden um ein Wesentliches abgebremst wurde. Als sie die wenigen Meter hinabstürzte und am Boden ankam, lösten sich die Bänder um ihren Körper und sie sah dann erst, dass Anon wesentlich härter auf dem Boden aufgeprallt war als sie selbst. Hatte er all seine Kraft darin investiert, nur um sie zu schützen? Sie stand auf und ging zu ihm, um zu überprüfen, wie es ihm ging.
„Geht schon“, schnaufte Anon. Offensichtlich ging es ihm nicht gut, da er nicht einmal mehr seinen Gesichtsausdruck kontrollieren konnte und sich somit sein Schmerz darin widerspiegelte.
„Warum hast du das gemacht!?“, warf sie ihm wütend vor. Sie verstand nicht, wie er sich selbst in diesem Zustand für sie vollkommen aufopfern konnte.
Doch die Wut, die Kioku auf Anon hatte, musste sie schnell vergessen. Nafsu sprang mit der Leichtigkeit einer Feder von einem Felsen zum nächsten, hinab auf die Ebene, auf der das Lagerfeuer brannte und sich die beiden befanden. Kioku ballte ihre Fäuste. Als Nafsu sich dann ein paar Meter vor ihr die Frisur richtete, als wäre das alles keine Anstrengung für sie, fiel Kioku wieder ein, wie sie von ihr gerade genannt worden war. Sie blickte zu Anon, der sich gerade auf seine Unterarme stützte, um sich kurz danach aufzurichten.
„Ihr zwei Hübschen seid mir ja doch gefolgt“, bemerkte Nafsu. „Da haben meine kleinen Fährten euch ja doch hierher gebracht. Dachte schon, ihr würdet darauf nicht reinfallen.“
Kioku spürte einen stechenden Schmerz in ihrer Brust und in ihrem Kopf. Warum mussten jetzt wieder diese ätzenden Kopfschmerzen einsetzen? Sie versuchte, sich zu konzentrieren, doch ihre Schmerzen verklärten ihre Wahrnehmung. Anon stand hinter ihr, hielt einen Arm um seinen Oberkörper umschlungen und war kaum noch imstande zu stehen. Vor ihr befand sich ihre Gegnerin, die sie gerade mit einem völlig fremden Namen angesprochen hatte. Was hatte das zu bedeuten?
„Wenn ich mir das so anschaue“, lachte Nafsu und betrachtete abwechselnd ihre Fingerspitzen und die beiden, „Sehe ich ein Liebespaar, dessen Liebe nun ein jähes Ende finden wird. Die Schönheit der Tragik, der Verlust, die Angst, das Ende – ist das nicht wunderschön?“
„Von was redest du da?“, wunderte sich Kioku, die sich keinen Reim darauf machen konnte, was sie damit aussagen wollte.
„Es ist wie ein klassisches Märchen. Er versucht sie zu beschützen und beide bezahlen ihre Liebe mit ihrem Leben. Ist das nicht romantisch? Nur wird die Geschichte von Anon und Aoko keiner hören“, sprach sie weiter, „Ich merke mir alle Namen von Leuten, denen ich etwas nehme.“
„Ich heiße Kioku“, betonte sie und blickte zurück zu Anon, dessen Gesichtsausdruck sich zu einem schockierenden Entsetzen änderte. Das machte Kioku Angst. „Wer ist Aoko?“
„Nun, das ist jetzt aber wirklich interessant“, stellte Nafsu fest und kam einen Schritt näher.
Kioku ballte ihre Fäuste, sie war bereit zu kämpfen.
„Nicht“, bat Anon schwach und hielt inne. Er schien nicht zu wissen, was er sagen sollte.
„Anon, wer ist Aoko?“, fragte Kioku noch einmal nach.
„Komisch, vorhin hat er dich so genannt, als ich dich k.o. geschlagen habe, um dir dein Band zu stehlen“, erklärte Nafsu und demonstrierte mit einem siegessicheren Lächeln, dass sie Kiokus Band um ihr linkes Handgelenk gewickelt hatte. „Habe ich da etwas missverstanden und ihr seid gar kein Paar?“
„Kioku, ich …“, setzte Anon an, doch er brachte nichts weiter heraus.
„Als was passiert ist?“, wunderte sich Kioku. Sie konnte sich einfach nicht an den Moment erinnern, als ihr das Band abgenommen worden war. Sie ließ ihre Fäuste fallen und wandte sich Anon zu. Die Art und Weise, wie er sie ansah, verriet ihr, dass er etwas wusste. „Anon, von was spricht sie? Hat das etwas mit meinen Erinnerungslücken zu tun?“, schlussfolgerte sie.
„Wer ist denn jetzt Kioku?“, wunderte sich Nafsu und kam unbemerkt wieder näher. „Jetzt wird das Ganze aber spannend!“
„Kioku, ich …“, stammelte Anon und sie sah, dass er mit den Zähnen knirschte und wässrige Augen hatte. Sie konnte nur nicht deuten, ob er wegen seiner Schmerzen oder dem, was er nun sagte. „… ich habe dein altes Ich gefunden. Du bist Aoko.“
In jenem Moment legte sich eine merkwürdige Schwärze vor ihre Augen. Wie in einem kalten Zeitraffer, der ihre ganze Körperwärme stahl, fächerten sich vor ihrem inneren Auge etliche Bilder von Ereignissen auf, an die sie sich scheinbar zu erinnern versuchte. Eine ältere Frau, die aussah wie sie selbst, warf sich bei einem Angriff von einer Gruppe Männern vor sie, um sie zu beschützen. Kioku fiel von einer Klippe und sah nur noch in Schemen, wie ihre Mutter getötet wurde. Unfassbar kaltes Wasser umspülte auf einmal ihren Körper, als sie hart wie ein Stein auf der Meeresoberfläche aufprallte und sich dabei ihren Kopf an der Stelle verletzte, an der sie nun die Narbe trug. Das schwarze Tuch umwickelte sie nun fester und schien ihr den Atem zu rauben. Tränen füllten ihre Augen, mit denen sie sich anstrengte, das zu sehen, was vor ihr war.
In der aufsteigenden Panik, die ihren Körper in Besitz nahm, verlor sie komplett die Kontrolle über ihre Körperfunktionen. Ihre Atmung wurde schneller und schneller, während sie immer mehr das Gefühl bekam, nicht atmen zu können. Ihre Gliedmaßen zitterten und schienen jeden Moment jegliche Kraft zu verlieren. Wenn sie jetzt zu Boden fiel, das wusste sie, würde sie so schnell nicht mehr aufstehen.
Ihr Tunnelblick ermöglichte jedoch noch zu erkennen, dass plötzlich ein blonder Mann aus der Höhle neben ihr trat. Zwei Strähnen dunklen Haares standen von seiner Stirn ab und bildeten im Halbschatten des Abends bösartig wirkende Hörner. Über seiner dunklen Jacke lag sich ein kurzer violetter Umhang über seinen Schultern. Silberne Protektoren beschützten seine Beine und Arme, während goldener Schmuck seinen Kopf und Kleidung zierte. Der Blick dieses Mannes, dessen tiefrote Augen sie und Anon gleichzeitig zu fixieren schien, entblößte seine Zähne in einem teuflischen Grinsen.
Kioku streckte ihren Arm aus, um Anon zu warnen, doch da hatte dieser Mann Anon schon längst überwältigt. Nun drangen weitere Bilder in ihren Kopf und die Kopfschmerzen nahmen so intensiv zu, dass Kioku nur noch mitbekam, dass sie fiel. Dann bekam sie nichts mehr mit, außer die Schwärze, die sie umhüllte.
Kapitel 58 – Das Wiedersehen
Der Raum in der Höhle war tatsächlich um einiges größer, als die Geschwister angenommen hatten. Es befanden sich mehrere Wasserbecken aneinandergereiht in dem ausgehöjlten Bereich der Höhle, den sie vorher nicht hatten erkennen können, weil sie sich direkt darüber befanden. Von hier unten sah die Felsformation mit dem kleinen Schlitz im Gestein, durch den sie gerade noch hinabgesehen hatten, wie ein kleiner Balkon aus. Die zwei Kerzen, die in diesem Raum leuchteten, schenkten nur so wenig Licht, dass man einige Ecken nur als pechschwarze Wand wahrnahm, von der man nicht wusste, was dahinter lag. Vielleicht war der Raum noch größer, als er auf die Geschwister wirkte.
Die Frau mit den langen blauen Haaren, die aus der Nähe sehr jung aussah, hatte die Geschwister nach unten geführt. Die Aura, die sie umgab, war mythisch. Sie strahlte eine unfassbare Stärke aus, verhielt sich zur selben Zeit jedoch so ruhig, dass man dadurch selbst ruhig wurde.
Dann, auf den zweiten Blick in den Raum, entdeckten die Geschwister einen Mann stehen, dessen kurze, weiße Haare struppig von seinem Kopf standen. Erst, als er sich zu den Geschwistern umdrehte, war ihnen klar, dass dieser Mann wirklich die Person war, nach der sie so lange gesucht hatten. Die lange Suche hatte offensichtlich ein Ende. Ihr Vater stand vor ihnen.
Was Takeru in diesem Moment zu ignorieren schien, war, wie Alayna wie angewurzelt dastand und sich nicht bewegte. Während er auf seinen Vater zurannte und ihm in die Arme sprang, rührte sich Alayna nicht und betrachtete alle in diesem Raum mit strengem Blick.
Als nächstes fiel ihr der leblose Körper des Wolfes auf, der aus dem Becken gezogen worden war und nun halb im Schatten lag. Sie sah nur die untere Hälfte des Tieres, das gerade noch vor Leben gestrotzt hatte, sich nun aber nicht mehr rührte. Eine stechende Kälte fuhr durch ihren Körper, also zwang sie sich schnell wegzusehen. Dann sah sie zurück zur Frau mit den blauen Haaren. Ihr Blick war jedoch auf etwas anderes gerichtet. In der Nähe der Wasserbecken sah Alayna zu, wie der Mann, dessen Gesicht mit einem Verband umwickelt war, dem Mann, der gerade noch im Wasserbecken gelegen hatte, half sich abzutrocknen. Beide wirkten unheimlich und streng. Weit auf der rechten Seite des Raumes stand zu ihrer Verwunderung Jumon. Sofort erinnerte sie sich, wie sein Sohn Vido damals auf die Welt gekommen war, als sie bei Jumon auf den verschneiten Bergen zu Besuch gewesen waren.
Das Erschreckendste war jedoch, als sie zusah, wie ihr Vater ihren Bruder in die Arme schloss und dabei ihr direkt in die Augen sah. Diese klaren, türkisen Augen, wie sie selbst sie hatte, strahlten Angst aus. Es war genau dieser Gesichtsausdruck, den ihr Vater hatte, den sie noch niemals in ihrem Leben zuvor gesehen hatte und der daran Schuld war, dass ihre Beine das Zittern anfingen. Ihr Blickfeld verengte sich zu einem Tunnel und plötzlich nahm sie die Kälte, die sich im Raum befand, nun auch in sich selbst wahr. Sollte es das gewesen sein? Die Suche nach ihrem Vater war nun beendet. Sie hatten ihn gefunden. Dann knickten ihre Knie ein und sie brach zu Boden, wie, als würden die vielen Fragen, die sie nun hatte, zu viel Gewicht haben. Es fühlte sich an, als würde ein fremder Mann ihren Bruder in die Arme schließen. Es geschahen viel zu viele Dinge auf einmal, die sie nicht verstand.
Takeru fühlte sich mit jedem Schritt, den er auf seinen Vater zulief, leichter. Die Wut und die Anspannung, die er in den letzten Wochen aufgebaut und aufgestaut hatte, verschwanden sofort. Er schmiss sich mit seinem vollen Körpergewicht gegen seinen Vater und wurde in einer starken Umarmung willkommen geheißen. Er vergoss ein paar Tränen der Freude, als er sein Gesicht fest gegen den Körper seines Vaters presste. Dabei spürte er, dass sich sein Vater anders anfühlte; er war härter als er es gewohnt war. Der sonst so vertraute Geruch nach Zuhause und Büchern haftete nun nicht mehr an seinem Vater und wich einer unbekannten Mischung aus Schweiß und Fremde. Hätte Takeru seinen Vater nicht mit seinen eigenen Augen gesehen, würde er daran zweifeln, dass er es wirklich war.
Doch das war Takeru egal. Die Erleichterung nach all seinen Mühen und Ermutigungen seine Freunde und seine Schwester dazu gebracht zu haben, es so weit zu schaffen, empfand er selbst wie eine goldglänzende Trophäe, die ihn mit Stolz erfüllte. Endlich hatte er seinen Vater gefunden.
Dann löste sich sein Vater von seiner Umarmung und Takeru sah zu, wie er auf Alayna zuging, die auf ihren Knien am Boden saß. Sein Vater schüttelte mehrmals den Kopf, als er Alayna am Oberarm packte und ihr aufhalf. Es sah für einen Moment so aus, als würde Alayna ihrem Vater ausweichen und gar nicht in seiner Nähe sein wollen.
„Was macht ihr hier?“, forderte sein Vater zu wissen. Dabei hatte er diesen strengen Ton in der Stimme, bei dem Takeru immer wusste, dass es jetzt ernst wurde. „Warum um alles in der Welt seid ihr ausgerechnet an diesem Ort?“
Dann warf sein Vater einen vorwurfsvollen Blick zu Jumon, der jedoch nur verteidigend seine Hände hob.
„Papa, wir haben dich endlich gefunden!“, platzte es stolz aus Takeru heraus. „Wir sind deinen Spuren gefolgt, als du damals entführt worden bist. Wir sind endlich so weit gekommen, um dich zu retten!“
Alayna rieb sich fröstelnd die Oberarme; sie hatte gerade nichts zu sagen, während sie ihren unsicheren Blick noch einmal durch den Raum schweifen ließ. Takeru erkannte nicht, in was für einer Situation er gerade steckte und dass das, was er gerade sagte, anscheinend fern von der Realität war.
„Was sprichst du da?“, fragte Ginta und ging vor seinem Sohn auf die Knie. Dann packte er ihn an der Schulter – eine Geste die man sich als Elternteil irgendwann einmal angewöhnte, um seinen Worten mehr Bedeutung zu verleihen. „Tak, was redest du da? Ich bin entführt worden?“
„Du bist doch damals diesem Licht hinterher, im Wald! Alle haben dich gesucht! Mama war weg und unser Haus hat gebrannt; es war so gefährlich; ich habe dein Buch gefunden, das Tagebuch! Und der Anhänger! Wir wissen jetzt ganz viel über jemanden namens Shiana. Da war diese Organisation; wir dachten sie haben dich entführt und dann waren da Ea und Laan und …“
Sein Vater sah ihn dabei jedoch nur mit einem verständnislosen Blick an. Takeru konnte das große Durcheinander in seinem Kopf gar nicht so erklären, wie er es gerne wollte. Er war ganz außer Atem, weil er zwischen den Sätzen keinen Atemzug nahm und je mehr er erzählte und weniger sein Vater wohl verstand, desto fester und enger wurde dieser Knoten in seinem Bauch, der zu schmerzen anfing. Langsam realisierte er, dass alles, was er sich vorstellte, wie seine Suche nur ausgehen könnte, eine merkwürdige Fantasie war, die nie in Erfüllung gehen sollte. Sein Vater signalisierte ihm, dass er sich beruhigen und atmen sollte.
„Tak, schau dich um. Ich wurde nicht entführt. Mir geht es gut, aber …“ Ginta machte eine Pause und sah sich seine Freunde an. Die Frau mit den blauen Haaren und Jumon wirkten ratlos, während die zwei anderen Männer sich an ein Steinpodest lehnten. „Was macht ihr hier?“
„Hast du gerade ‚Ea und Laan‘ gesagt?“, hakte Jumon neugierig nach, der einen bestätigenden Blick von der Frau mit den blauen Haaren suchte.
„Ja, sie waren bis gerade noch vor der Höhle und haben etwas gesucht!“, erklärte Tak. „Ea ist eine Weile mit uns unterwegs gewesen und hat Laan gesucht. Ich versteh das alles erst, seit wir das Tagebuch gelesen haben.“
„Ihr habt das Tagebuch gelesen?“, fragte Jumon verwundert und machte dann eine Geste, als würde er sich wieder erinnern. „Stimmt, wir haben dort oben unsere Taschen liegen gelassen.“
„Ginta, Gaara“, meldete sich nun die Frau zu Wort. „Wenn die beiden in der Nähe sind, wird es nur umso gefährlicher.“
Ginta seufzte, stand auf und fuhr sich frustriert durch sein Haar.
„Was soll das alles hier?“, verlangte nun der Mann mit dem verbundenen Gesicht und den langen schwarzen Haaren zu wissen.
Da schreckte Ginta plötzlich auf und schien seine Aufmerksamkeit plötzlich auf etwas anderes zu lenken. Er wandte sich zu dem anderen Mann, dessen weißgrauen Haare am Ansatz einen roten Schimmer zu haben schienen.
„Gaara, wie geht es dir?“, fragte Ginta, den anderen Mann ignorierend. Takeru erkannte, dass es sich um den Mann handelte, der gerade erst ins Wasser gezogen und mit dem irgendein Ritual durchgeführt worden war. Oder täuschte sich Takeru? Hatte er gerade nicht noch Gedo geheißen?
Jetzt schien auch die blauhaarige Frau zu reagieren und stürzte sich auf den Mann, der nun Gaara hieß. Wenn er also Gaara war, konnte es sein, dass sie Shiana war? Takeru war von den ganzen Ereignissen, die gerade geschahen, enorm verwirrt.
„Shiana“, begrüßte Gaara die Frau und nahm sie fest in den Arm. „Wir haben uns so lange schon nicht gesehen. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit.“
„Endlich haben wir es geschafft, dich zurückzuholen“, sprach sie mit einer sanften Stimme. „Das haben wir alles Gedo zu verdanken.“
„Er ist nicht ganz verschwunden, nicht wahr?“, erklärte nun Jumon. Takeru wunderte es, dass ausgerechnet er an diesem Ort war.
„Ich spüre ihn immer noch“, fügte Jumon noch hinzu.
Gaara trat hervor und legte sich dabei eine Hand auf die Brust. „Ja, ich spüre ihn auch noch. Er ist nicht ganz verschwunden. Ich bin sehr dankbar, dass er mir seinen Körper geschenkt hat.“
„Dann können wir den nächsten Schritt des Planes angehen“, forderte der Mann mit dem Verband im Gesicht.
Danach unterhielten sich Gaara, Jumon und Ginta mit ihm über irgendwelche Einzelheiten. So gern Takeru auch zugehört hätte; er konnte es nicht. Die Informationen aus dem Tagebuch, die er gerade noch gelesen hatte und die Geschehnisse, die gerade passiert waren, vernebelten für einen kurzen Augenblick seine komplette Wahrnehmung. Er konnte sich nicht auf die Gespräche der Erwachsenen fokussieren. Takeru versuchte sich dazu zu zwingen, die Zusammenhänge zwischen den jetzigen Ereignissen und dem Text im Tagebuch besser zu verstehen.
Gaara und Shiana waren verliebt. Sie hatten in einem Krieg gekämpft, der schon lange her war. Ea und Laan waren ebenfalls an ihrer Seite gewesen. Sein Vater war einfach verschwunden und tauchte hier in der Wüste, wie es Kioku vermutet hatte, einfach auf. Jedoch musste er eine Opferung durchführen mit einem merkwürdigen Wolf und einem Mann, dessen Gesicht verbunden war. Wer war dieser Kerl überhaupt? Tausende Fragen umspülten Takerus Verstand. Vielleicht konnte Alayna ihm helfen, das alles besser zu verstehen. Doch sie stand nur hinter ihm, rieb sich besorgt schauend die Oberarme und bewegte sich kein bisschen von der Stelle.
So sehr sie auch versuchte, die Ruhe zu bewahren, raste Alaynas Herz unkontrolliert. Das Einzige, das ihr in den Sinn kam, war eine Erkenntnis, die schmerzhaft war. Sie kannte den Mann, der ihr Vater war, nicht mehr. Er stand dort, unterhielt sich mit den anderen Erwachsenen, wie, als wäre sie selbst Luft. Sie realisierte langsam, dass sie nichts über ihre Eltern wusste. Das, was sie die letzten Jahre zusammen erlebt hatten, empfand sie nun als eine merkwürdig künstliche Fassade, weit entfernte Erinnerungen, die nicht mehr echt zu sein schienen. Wem war sie so lange hinterhergelaufen? Ihrem Vater? Die Art und Weise, wie sie von ihren Eltern im Stich gelassen wurde, fühlte sich wie ein Verrat an. Was ihr Bruder wohl fühlte? Er wirkte interessiert an dem Geschehen und gar nicht so aufgebracht; wie sie selbst. Gerade, als sie ihn beobachtete, wie er etwas sagen wollte, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, kam sie ihrem Bruder jedoch zuvor. Zu ihrer eigenen Überraschung brachte ihre Anspannung sie dazu, etwas zu sagen: „Was soll das alles!?“ Sie brüllte, obwohl sie das gar nicht wollte. „Ich verlange eine Erklärung!“
Der erste, der auf sie reagierte, war der Mann mit dem verbundenen Gesicht. „Was auch immer ihr hier wollt, für einen Kindergarten ist hier keine Zeit“, drohte ihr der Mann. Alayna sah, mit was für einem eiskalten Blick er sie fixierte und fror auf der Stelle ein. Die Aura, die diesen Mann umgab, schwebte wie ein tödliches Gas um ihn herum. Er sprühte pure Gefahr und Gewalt aus. Was hatte ihr Vater mit ihm nur zu tun?
„Lass das“, befahl Ginta in einem ruhigen Ton, „kein Grund, so aggressiv zu sein, Riven.“ Ihr Vater schenkte ihr einen Blick, der bedeutete, noch ein klein wenig Geduld zu haben. Er schien bereit zu sein, ihnen die nötigen Informationen zu geben, die sie hören wollten.
„Dann erkläre mir doch bitte, was deine Kinder hier verloren haben“, forderte Riven zu wissen, während er sich auf einen der steinernen Tische abstützte. Die Hand, mit der er sich abstützte, war ebenfalls in einen Verband eingewickelt.
„Ich will wissen, was hier los ist!“, forderte auch Takeru.
„Wir haben keine Zeit für euch“, warf Riven den beiden vor. „Wir müssen uns an den Plan halten.“
„Jedoch gibt es noch einige Informationen, die wir untereinander noch austauschen müssen“, wandte der Mann namens Gaara ein.
„Wissen ist Macht“, stimmte Jumon mit ein. „Ich weiß, dass du sofort handeln willst, Riven. Wir sind noch nicht dazu gekommen, unsere Wissensstände abzugleichen. Das muss zuerst passieren.“
„Außerdem“, fing Ginta an und wandte sich dabei zu seinen Kindern. Er legte beiden eine Hand auf die Schulter. „Ihr seid meine Kinder und ich schulde euch meine Ehrlichkeit. Wir müssen uns die Zeit nehmen, uns die Dinge zu erzählen, die passiert sind, um zu verstehen, wie das alles hier ausgehen wird.“
Nachdem sie sich um einen der steinernen Tische stehend versammelt hatten und Ginta mit seinen Kindern etwas aus seinem Wasserschlauch zu trinken teilte, fing er an, alles zu erklären. Takeru hörte aufmerksam zu.
„Jumon muss ich euch ja nicht mehr vorstellen“, fing Ginta an zu erzählen. „Das hier ist Riven Kire Anbibarensu, der Anführer der Vastus Antishal und ein langjähriger Freund meinerseits.“
„Aber Arec ist doch der Anführer der Vastus Antishal“, stellte Takeru fest. „Der echte Anführer ist gestorben, vor langer Zeit.“
„Das ist das, was jeder denken soll“, gab Riven zu und wandte sich dabei zu dem anderen Mann. „Ich habe ihn getroffen, bevor ich dich gefunden habe, Gaara.“
„Erzähl mir, was geschah, als du Miraa konfrontiert hast“, bat Gaara und schenkte Shiana dabei einen besorgten Blick.
„Miraa? Ist das nicht dein bester Freund?“, erklärte Takeru mit seinem Wissen, das er aus dem Tagebuch hatte.
„Mir scheint, als wüsstest du so einige Geheimnisse von uns“, gab Gaara zu und konnte ein kleines Lächeln nicht verbergen. „Ich bin erstaunt, wie viel du weißt. Jedoch ist Miraa das Problem. Seit über viertausend Jahren schon versucht er immer wieder die Welt radikal zu zerstören.“
„Ich konnte ihn aufspüren“, erklärte Riven weiter. „Nachdem wir damals die Welt gerettet hatten, habe ich nicht aufgeben, nachzuforschen. Ich kam dank Jumon darauf, dass es neben den Shal, die einst versucht hatten, die Welt zu zerstören, noch eine weitere Gruppe gab, die im Verborgenen agierte. Der Geheimbund der Kinno-Bujin hatte sich tausende Jahre lang weiterentwickelt, ohne dabei entdeckt zu werden. Als wir damals den Kampf gegen den Mann namens Xarmainion gewonnen hatten, konnte ich in Erfahrung bringen, dass er auch nur eine von vielen Schachfiguren war, die Miraa Liade befehligte. Außerdem habe ich erfahren, dass die Leute, die er momentan um sich gesammelt hatt, sehr gefährlich sind. Dann, als Miraa wieder eine feste Gestalt annahm, konnte ich ihn durch die Spuren, die er dabei hinterließ, ausfindig machen.“
„Wie hast du das geschafft?“, wollte Gaara neugierig wissen.
Takeru beobachtete, wie sein Vater anfing zu grinsen, vielleicht weil er darauf die Antwort schon wusste.
„Ich habe die Kinno-Bujin schon sehr lange studiert“, erklärte nun Jumon weiter. „Ich fing an, alle Schriften über diese Gruppierung und deren Taten zu sammeln und zu analysieren. Miraa Liade selbst hatte Bücher verfasst, die ‚Chroniken der Nebenwelt‘ genannt und dabei – so stolz er darüber anscheinend war – viel zu viele seiner Ideale geteilt. Durch die Informationen, die er beschrieb, habe ich ebenfalls erfahren, dass der Bund der Unsterblichkeit, den er mit dir teilt, Gaara, einem regelmäßigen Zyklus folgt. So wie sich deine Seele von selbst immer wieder Körper sucht, in denen sie hausen kann, schaffte Miraa Liade es immer öfter, sich ganz kontrolliert einen Körper zu suchen. Jedoch war der Preis dafür ein strenger festgelegten Zyklus.“
„Was hat das zu bedeuten?“, hakte Gaara interessiert nach.
Für Takeru waren die neuen Informationen mehr als interessant. Endlich hatte er die Chance, die ganzen Geheimnisse hinter dem Tagebuch, den Artefakten und der Geschichte seines Vaters zu lüften.
„Der Preis dafür, sich einen Körper seiner Wahl zu nehmen, war durch einen Jahresrhythmus gebunden. Er muss Jahrhunderte lang damit beschäftigt gewesen sein, diesen Zeitraum abzupassen, um dann zu sterben. Wie es mir scheint, war Selbstmord für ihn keine Lösung; es musste durch ein äußeres Ereignis stattfinden. Jedoch bin ich mir bei diesem Punkt noch nicht ganz so sicher.“
„Das ist ja schrecklich“, murmelte Shiana.
„Dank Jumons Unterstützung konnte ich ihn also ausfindig machen“, fuhr Riven fort. „Ich konfrontierte ihn allein. Ich weiß, dass du das für sehr dumm hältst, Ginta. Jedoch war es genau die richtige Entscheidung. Dadurch konnte ich sichergehen, dass keine weiteren Personen ums Leben kamen. Das Einzige, das ich in diesem Kampf nur opfern musste, war mich selbst.“
„Wie hast du den Kampf überlebt?“, wollte Ginta wissen. „Das hast du mir bisher nie erzählt.“
„Noch nie hatte ich so einen außergewöhnlichen Kampf mit jemanden geführt“, erzählte Riven nahtlos weiter. „Diese Macht, die Miraa innehält, ist enorm. Er attackierte mich mit allem, was er hatte. Es schien, dass das Genkioken ihn auf eine merkwürdige Weise wütend machte. Das führte dazu, dass er immer wieder unkonzentriert war. Ich beobachtete ihn während des Kampfes, um Lücken in seinem Angriffsverhalten zu analysieren. Diese Lücken konnte ich ausnutzen und so meinen Tod vortäuschen.“
„Was ist das Genkioken?“, wunderte es Takeru, der sich ein bisschen nach vorn lehnte, um etwas Aufmerksamkeit zu bekommen.
Bevor er und seine Schwester eine Antwort bekamen, streckten jeweils Gaara, Riven und auch ihr Vater eine Hand nach vorn. Vom einen auf den nächsten Augenblick fingen ihre Hände blaues Feuer. Es dauerte nicht lange, dann erloschen die Flammen. Takerus Augen wurden groß.
„Das blaue Feuer haben wir gesehen“, meldete sich Alayna zu Wort, der die Art und Weise dieser Energieströmung merkwürdig bekannt vorkam. „Als ihr vorhin dieses Ritual durchgeführt habt und …“
„Das Ritual erkläre ich euch später“, meinte ihr Vater und erklärte, was das Genkioken bedeutete. „Diese Technik ist ein uralter, besonderer Energiefluss, der mich, Riven und auch Gaara miteinander verbindet. Warum ausgerechnet wir diese Macht in uns tragen, ist mir immer noch nicht klar. Jedoch haben wir dieses Schicksal akzeptiert.“ Dann wurde Ginta etwas stutzig und hakte noch einmal nach: „Was genau meinst du mit ‚und‘?“
Alayna sah, wie ihr Vater sie auf einmal besorgt ansah.
„Ich habe diese Energie schon einmal in mir gespürt. In Tak auch, jedoch hatte diese Energie dort eine andere Farbe.“
Gintas Augen weiteten sich, als Alayna diese Aussage machte. „Jumon, stimmt das?“, forderte er zu wissen.
Jumon ging auf die Geschwister zu, nahm jeweils eine ihrer Hände und schloss die Augen.
Alayna erinnerte sich, dass er eine besondere Gabe hatte, die es ihm ermöglichte, Geister, Seelen und Energien zu sehen.
Kurz nachdem er die Augen geschlossen hatte, öffnete er sie wieder und nickte.
„Ja, ich sehe die gleichen Energiestränge wie bei euch. Als ich dies das erste Mal gesehen habe, waren sie noch so schwach; ich war mir nicht sicher. Jetzt bin ich es aber. Eines jedoch ist komisch. Takerus Strang ist unterbrochen, wie durch eine Blockade. Ich habe dir mal einen Gefallen getan und sie gelöst.“
„Das ist nicht gut“, murmelte Ginta in sich hinein.
„Das stimmt“, bestätigte Gaara. „Miraa wird auch hinter euch her sein. Der Fluss des Genkioken ist das Einzige, das ihm Angst macht.“
„Warum? Ich verstehe das nicht“, fragte Takeru nach.
Alayna war sich nicht sicher, was das zu bedeuten hatte. Sie fand es nicht gut, dass Jumon die Blockade, die Oto für Takeru erschaffen hatte, nun einfach gelöst hatte. Sie befürchtete, dass ihr Bruder wieder seine Kontrolle verlieren könnte. Jedoch behielt sie diese Sorgen für sich. Sie musste erst mehr von all den Geschehnissen verstehen, bevor sie das einbringen konnte.
„Ich befürchte, er sieht darin den Schlüssel unserer Unsterblichkeit. Nein, eher das Ende unserer Unsterblichkeit“, führte Gaara weiter aus.
„Das bedeutet“, wandte sich Ginta nun wieder zu seinen Kindern, „dass ihr zurück in die Stadt müsst. Ich werde Ryoma beauftragen, dass er auf euch aufpasst.“
„Nein!“, protestierte Takeru, zum Erstaunen seines Vaters und der anderen im Raum. „Ryoma will auf uns gar nicht aufpassen. Außerdem wissen wir, wo die Artefakte sind!“
Vielleicht konnte er seinen Vater überzeugen, dass sie nicht zu Ryoma geschickt werden mussten, wenn er dieses Thema ansprach. Laut dem Tagebuch schienen die Artefakte eine besondere Kraft und Bedeutung zu haben. Er empfand es als gutes Überzeugungsmittel, das nun anzusprechen. Er kramte unter seinem Oberteil seinen Kompass hervor, der ihnen vorher den Weg geleuchtet hatte. Stolz präsentierte er das metallene Objekt. „Das ist Laans Kompass. Übrigens hat Eimi das Schwert von Ea. Wir müssen nur noch den Anhänger finden, dann haben wir alle Waffen und können der Gefahr ein Ende setzen.“
Nun holte auch Shiana etwas unter ihrem Oberteil hervor, was sich als kleiner Anhänger in Form einer Feder herausstellte.
„Ich habe den Anhänger“, sagte sie in einem ruhigen Ton.
„Papa, ihr habt das Tagebuch doch auch gelesen; das sind die drei Waffen, mit denen Ea, Laan und Shiana noch mächtiger werden. Wir müssen keine Angst vor Miraa haben. Können wir nicht einfach die Kräfte vereinen und ihm einen Strich durch die Rechnung machen? Ihr habt das damals doch auch geschafft? Wir haben Laan erst vor kurzem getroffen; er meinte, er wolle den Kompass später abholen“, erklärte Tak und bezog sich dabei auf die letzten Einträge des Tagebuches, als Shiana gemeint hatte, sie würden ihren Plan umsetzen. „Dann müssen wir nur Eimi bitten, Ea das Schwert zurückzugeben und alles ist gut.“
„Ich befürchte, dass es nicht so einfach ist“, wandte Jumon ein. „Zudem wird ein Opfer gefordert werden.“
Zu Alaynas und Takerus Überraschung senkten Jumon und ihr Vater besorgt die Köpfe. Gaara lehnte sich entspannt an den Tisch und fuhr sich unbeschwert durch die Haare. „Wenn Miraa sterben muss“, erwähnte er melancholisch, „dann werde ich auch sterben müssen. Das ist unser Bund, den wir teilen.“
„Aber Gaara“, versuchte Shiana anzusetzen, doch ihr schien es die Sprache verschlagen zu haben. Besorgt rieb sie sich ihre Schultern.
„Ich habe sehr lange Zeit gehabt, darüber nachzudenken, Shiana“, sprach Gaara sie direkt an. Dabei nahm er eine ihrer Hände und die Geschwister konnten im Dunkeln trotzdem erkennen, dass ihr Gesicht errötete. „Nach so vielen Jahrhunderten ist die Zeit nun gekommen, meinem Schicksal ins Auge zu blicken.“
Alayna rauchte der Kopf. Alles, was sie erfahren hatte und was in letzter Zeit passiert war, machte ihr nicht nur Angst und Sorgen, sondern auch Kopfschmerzen. Jedes Mal, wenn sie versuchte, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, stolperte sie immer und immer wieder über ein und dieselbe Frage: Wo war ihr Vater die ganze Zeit gewesen und warum tauchte er jetzt plötzlich wieder auf?
Gerade, als die Erwachsenen wieder irgendwelche Details austauschten, platzte ihr erneut der Kragen. Sie wollte nichts über die Artefakte wissen. Sie wollte nur wissen, wo ihr Vater gewesen war.
„Papa“, fing sie an und merkte dabei, dass die ersten Tränen ihre Wange hinabflossen. Die Angst und Sorge, nicht zu wissen, was vor ihr lag, veränderte ihre Stimme. „Wo warst du die ganze Zeit? Wo warst du!? Wir sind durch die Hölle gegangen, ohne dich. Du weißt gar nicht, was alles passiert ist, was wir durchlebt haben! Du warst nicht da – du hast uns nicht beschützt – du bist jemand ganz anderes – ich erkenne dich gar nicht wieder!“, schluchzte sie plötzlich.
Riven, der bisher sehr ruhig geblieben war, rollte mit den Augen und seufzte lautstark, woraufhin er von Jumon einen bösen Blick kassierte. Ginta ging einen Schritt auf seine Tochter zu und nahm sie einfach in den Arm. Alayna schluchzte, ihr Gesicht an seine Brust gepresst und auch ihr fiel auf, dass der Geruch ihres Vaters nicht mehr an ihm haftete. Wie lange hatte sie sich nach dieser Umarmung gesehnt? Doch der bittersüße Geschmack dieser Umarmung zeigte ihr, dass Familie nie wieder das bedeuten sollte, was es für sie einmal getan hatte.
Shiana war die Erste, die etwas sagte.
„Euer Vater hat jeden Tag an euch gedacht. Er hat versucht, euch so viel Hilfe zukommen zu lassen, wie er nur konnte; das müsst ihr wissen“, erklärte sie das Geschehene. „Ginta hatte viel damit zu tun, mich zu finden und zurückzuholen. Dabei hatte er sich um so viele Sachen zu kümmern; aber das Erste, an das er jeden Morgen dachte, wart ihr.“
„Pa-Papa“, stammelte Takeru und er konnte ebenfalls die Tränen nicht zurückhalten.
Alayna löste sich langsam von der Umarmung ihres Vaters, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und sah ihm dabei direkt in die Augen. Für einen kurzen Moment sagte niemand etwas. Sie nahm die ganzen Feinheiten seines Seins plötzlich so wahr, wie sie es noch nie getan hatte. Sein kurzes Haar war etwas länger geworden und auch seine Falten schienen etwas tiefer zu sein. Ihr Vater musste müde sein; das zeigten seine Augenringe. Seine linke Hand zitterte leicht und Alayna spürte, dass auch er sich darum sorgte, wie alles weitergehen sollte.
„Es war nie mein Wunsch, euch allein zu lassen“, erklärte ihr Vater, ohne sich dabei zu entschuldigen. „Es gab viel zu viele Dinge, um die sich gekümmert werden musste. Ich bin sehr froh, dass ihr all den Gefahren, denen ihr begegnet seid, standgehalten habt. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, müsst ihr mir von allem erzählen.“
Alayna wollte alles erzählen. Alles, was sie durchgemacht hatte und wie sie gekämpft hatte. Sie wollte ihrer Wut Luft machen. Der Drang, sich darüber mitzuteilen und sich Gehör zu verschaffen, war enorm. Vielleicht verstand ihr Vater, was sie fühlte, aber sie musste sicher gehen.
„Ich will eure Familienzusammenführung wirklich nicht unterbrechen“, drängte sich Riven nun ins Gespräch. Er wirkte etwas erzürnter als noch vor einer Weile. „Aber es ist langsam Zeit, dass wir unseren Plan weiterführen, meinst du nicht?“
„Was bedeutet das, Papa?“, hakte Takeru nach, den es unglaublich interessierte. „Was passiert jetzt mit dem Kompass und dem Tagebuch? Wie gehen wir vor?“
„Wir?“, seufzte Ginta und deutete dabei mit einer Geste auf alle Erwachsenen. „Wir werden euch zurück in die Stadt schicken. Es ist nicht eure Aufgabe, die Welt zu retten.“
„Ich werde euch zurück in die Stadt begleiten“, schlug Jumon vor. „Jetzt, wo Gaara wieder zurückgekommen ist, werde ich den anderen Bescheid geben. Währenddessen hört ihr euch das Ende der Geschichte an.“
„Wir können doch Ea und Laan suchen, um ihnen die Artefakte wiederzugeben“, schlug Takeru vor.
„Es ist wohl besser, wenn du uns den Kompass gibst und uns das machen lässt“, forderte Gaara und streckte eine Hand aus, um den Kompass zu nehmen. Takeru zögerte jedoch, den Kompass zu überreichen.
„Aber …“, grübelte Takeru, um eine Ausrede zu finden. „Lasst mich den Kompass mit zurück in die Stadt nehmen. Wenn Jumon und wir dann Eimi treffen, sind Kompass und Schwert zusammen. Wir übergeben die Artefakte gemeinsam Jumon, dann könnt ihr sie ihren Besitzern Ea und Laan zurückgeben! Ich weiß, wie der Kompass funktioniert, deswegen hat er mich hierhergeführt.“
„Du weißt wirklich, wie der Kompass funktioniert?“, hakte Gaara neugierig nach. „Selbst wir haben nie herausgefunden, wie Laan das immer gemacht hat.“ Shiana nickte bestätigend.
Was hatte Takeru da gerade gesagt? Wusste er, wie er funktionierte? Er streckte seine Hand zögerlich aus; in der Mitte seiner Handfläche befand sich der Kompass. Wenn er jetzt so viel Glück hatte, zu beweisen, dass er den Kompass kontrollierte, durfte er vielleicht an der Seite seines Vaters bleiben.
Alayna sah ihn erstaunt und verwundert an. Bestimmt wusste sie, was er sich dabei dachte, ließ es aber zu. Dann schloss Takeru seine Augen, nahm einen tiefen Atemzug und wiederholte ein Wunschmantra: ‚Lass es mich beweisen, dass ich den Kompass kontrollieren kann.‘
Ein Raunen ging durch die Gruppe.
Ein hellgrünes Licht formte erst eine kleine, unförmige Kugel und wurde zu einem Strahl, der senkrecht nach oben schien. Der Lichtstrahl ging direkt durch die Decke der Höhle und verschwand. Das kurz aufleuchtende Licht erhellte plötzlich Ecken des Raumes, die man vorher nicht hatte sehen können und Alayna musste schlucken, als sie den leblosen Körper des Wolfes nun vollständig sah. Ein eiskalter Schauer lief ihr über den Rücken. Dann schenkte sie ihrem Bruder wieder all die Aufmerksamkeit. Er hatte es also wirklich geschafft! Hatte es damit zu tun, dass sein Energiefluss nicht mehr blockiert war? Hatte er einfach Glück? Oder kontrollierte er wirklich den Kompass? Ihr kleiner Bruder schien sich selbst nicht sicher zu sein.
„Ich habe es geschafft?“, meinte er und korrigierte sich dabei selbst, verkleidet mit einem nervösen Lachen. „Ich habe es geschafft!“
„Das verändert alles“, gestand Jumon. „Wir könnten die Suche dadurch beschleunigen.“
„Aber wir haben die Kinder bei uns, auf die wir aufpassen müssen. Das ist Ballast“, versuchte Riven, die Gruppe vom Gegenteil zu überzeugen.
„Papa“, meinte Takeru nur, als sein Vater sich wirklich Gedanken zu machen schien.
Alayna war sich in diesem Moment nicht sicher, was sie selbst wollte. Bei ihrem Vater bleiben? Eigentlich wäre sie gern zurück zu Eimi und den anderen gegangen. Aber irgendetwas hielt sie noch zurück. Sie wollte noch mehr wissen.
„Ich möchte noch etwas Zeit haben, um zu überlegen“, verkündete Ginta nach einer kurzen Nachdenkzeit. „Ich bin mir nicht sicher, wie ich entscheiden möchte. Außerdem wäre es sinnvoll, wenn du Gaaras Geschichte noch zuhörst, bevor du mit den Kindern gehst, Jumon. Wir brauchen jeden Kopf, um herauszufinden, wie wir Miraa bezwingen können.“
„Papa, was meinst du mit Gaaras Geschichte?“, hakte Takeru nach. Er hoffte wohl, es hinauszögern zu können, gehen zu müssen. Doch auch Alayna stellte fest, dass sie wissen wollte, was das zu bedeuten hatte.
„Nachdem wir das Tagebuch entschlüsseln konnten, konnte sich Shiana wieder an Sachen erinnern“, erklärte ihr Vater.
„Aber ich kann mich noch nicht an alles erinnern“, sagte Shiana ruhig und wandte sich zu Gaara. „Wir wollen wissen, an was du dich noch erinnerst. Damit wir herausfinden, wie wir Miraa damals bezwungen haben.“
„Nach über viertausend Jahren Leben sind einige Details verwischt“, erklärte sich Gaara. „Ich bin mir nicht mehr sicher.“
„Du musst es versuchen“, forderte Riven und sah Gaara mit einem strengen Blick an.
„Da haben wir eine Hilfe“, grinste Jumon und Ginta lächelte ihn auch an. „Der Anhänger von Shiana kann deine Erinnerungen vielleicht wieder erwecken.“
Shiana berührte mit ihrem Zeigefinger ihren Anhänger, der dann ein hellblaues Licht emittierte in Form einer blauen Kugel. Langsam schwebte diese Kugel zu Gaara und verschwand in seiner Stirn. Alayna und auch Takeru sahen dem Ganzen neugierig und gespannt zu.
„Der Anhänger war der Schlüssel, meine Erinnerungen mit dem Tagebuch zu wecken. Dieser Schlüssel wird auch dir helfen, dich besser zu erinnern“, sagte Shiana sanft. Die Art und Weise, wie sie sprach, beruhigte Alayna.
Gaara schloss seine Augen für einen Moment, nahm einen tiefen Atemzug und als er seine Augen wieder öffnete, leuchteten sie für einen kurzen Augenblick in dem gleichen hellblauen Licht auf, das der Anhänger ausstrahlte.
„Fang einfach an, zu erzählen“, bat Ginta. „Irgendwo werden Hinweise versteckt sein, die im Tagebuch nicht zu finden waren.“
„Verstanden“, bestätigte Gaara. „Dann werde ich euch über das Ende des Krieges vor über viertausend Jahren berichten …“
Kapitel 59 – Spezialkapitel
Gaaras Geschichte und der Krieg vor über 4000 Jahren
Teil I
„Was ich wollte, war ein Ende des Krieges. Jedoch dachte ich an manchen Tagen, dass ich der Grund war, wieso er so lange andauerte.“ – Gaara
Diese blauen Augen würden mir sehr lange nicht mehr aus dem Kopf gehen. Sie hatten mich gefesselt, mir einen Bann aufgezwungen und mich schwach gemacht. Lange verneinte ich die Gefühle, die in mir wach geworden waren, doch ich konnte ihnen nicht länger davonlaufen. Mir die Wahrheit einzugestehen, hatte mich viel Kraft gekostet. Nun kehrte ich ihr den Rücken.
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich niemals in den Krieg ziehen. Leider hatte ich keine Wahl. Der Fremdbestimmung ausgeliefert zu sein, schmerzte. Jedoch – so wie ich dort in der Kutsche saß und langsam zur Front gebracht wurde – musste mir bewusst werden, dass diese besondere Person nicht die Einzige war, die auf Schutz angewiesen waren. In unserem Land gab es viele Menschen, die beschützt werden mussten. Aber vor was wurden sie beschützt? Dem Feind? Wer war dieser Feind und was wollte er? Warum wurde gekämpft? Warum schaffte man es nicht, auf politischer Ebene eine Klärung zu finden?
Mein Name war Gaara und ich war Soldat in der königlichen Armee unserer Heimat. Unser Königreich war ein aus einer Oase entwickelter Stadtstaat inmitten einer riesigen Wüste. Die Rohstoffe, die uns das Oasenparadies in Form von Früchten und Pflanzen und das Gebirge durch seltene Erze schenkte , trugen dazu bei, dass unser Königreich schnell wuchs. Wir entwickelten komplexe Handelsbeziehungen mit der Außenwelt, vor der wir, mit einer Menge Sand dazwischen, in Sicherheit waren. Wir mussten nicht befürchten, dass fremde Nationen eindrangen und uns beraubten. Es hatte sich nie jemand getraut, das zu tun. Hilfreich war auch, dass unser König nie beabsichtigt hatte, unseren Reichtum zu vergrößern, indem wir den Reichtum der anderen stahlen. Doch der Krieg, der auf diesem Kontinent wütete, konnte aus Gründen, die mir damals noch nicht bekannt waren, nicht mehr ignoriert werden.
Als Soldat hatte ich einen enormen Vorteil: Ich durfte lesen lernen. Abgesehen davon, dass es einen strategischen Vorteil im Kampf hatte, lesen und schreiben zu können, um die Anweisungen des Heimatlandes zu verstehen oder um einen Vorteil gegenüber den fremden Streitkräften zu haben, genoss ich es, lesen zu dürfen. Das missfiel einigen meiner Kumpane zur damaligen Zeit. Viele von ihnen waren Bauernsöhne, die den Sinn nie verstanden hatten, lesen zu müssen. Sie waren einfache Leute mit einfachen Träumen. Einst aus dem Krieg zurückgekehrt, wollten sie eine schöne Frau heiraten, viele Kinder bekommen und die Landwirtschaft ihrer Väter übernehmen. Mir hatte das nie genügt. Angetrieben von der Neugier und der Fähigkeit zu lesen – eine Kombination, die sich später als schicksalsverändernd herausstellte – erlangte ich Zugang zu der königlichen Bibliothek im Schloss, in die ich mich in jeder freien Minute aufhielt. In dieser Bibliothek, einem kleinen Ort am Rande des Schlosses, erstreckte sich für mich die Welt und das ganze Universum. Ich las Berichte, Fiktion, Tagebücher und Schriften von Gelehrten. Ich erfuhr fast alles, was sich in der Vergangenheit abgespielt hatte, ich lernte über Fauna und Flora, Geographie, Biologie und Psychologie. Ich las von Abenteurern, Romantikern, Agnostikern und Theologen und lernte so viel über die Welt, die ich noch nicht hatte entdecken dürfen.
Es gab eine Geschichte, die mich lange nicht losließ. Ich war zwar nie religiös gewesen, aber diese Legende hatte mich als Kind, das auf der Suche nach Antworten des Universums gewesen war, gefesselt. Erst sehr viel später erinnerte ich mich wieder an diese Geschichte.
Die Legende der drei Götter.
Es heißt, es gab drei Götter. Wer den Anfang machte und zuerst kam und wer zuerst etwas tat, ist niemandem bekannt.
Der eine war der Beschützer, derjenige, der alles erschuf. Er kreierte die Sonne, die Erde, das Licht, das Wasser, die Natur, die Tiere und die Menschen. Jeder Stein, jedes Blatt, jedes Körnchen Etwas, das sich hier und dort draußen im endlosen All befand, wurde von seiner Hand mit Liebe erschaffen und hatte seine Berechtigung, zu sein. Er wurde deswegen der Beschützer genannt, weil er ein Schwert trug. Jedoch kämpfte und zerstörte er nie mit diesem Schwert, denn es hatte keine Klinge. Mit diesem Schwert erschuf er alles; und eben, weil er dies tat, beschützte er es damit.
Weil jedoch damals, als er alles erschuf, alles noch stillstand, trugen die beiden anderen Götter ihren Teil dazu bei, welcher alles veränderte.
Die Göttin war die Schreiberin. Sie schrieb mit ihrer Feder über alles; und weil sie das tat, gab es die Zeit. Sie schrieb allem eine Vergangenheit und eine Zukunft und dadurch, dass sie das tat, gab es die Jugend, das Alter und den Tod. Denn alles, das erschaffen wurde, hatte seine Zeit. Weil sich der Beschützer und die Schreiberin so gut verstanden, trafen sie eine Vereinbarung. In dieser Vereinbarung legten sie fest, dass, falls das Ende der Zeit für Etwas gekommen war, es nicht bedeuten musste, dass es verschwand. Der Beschützer gab den Kreationen eine neue Form, sodass sie nach dem Tod nie wirklich zerstört wurden, sondern in dieser neuen Form weiter existierten. Das gefiel der Schreiberin auch, die gerne neuen Kreationen eine neue Geschichte schrieb.
Doch diese Festlegung war dem dritten Gott nicht recht. Als Verfechter von Freiheit und mit der Überzeugung, dass Vorherbestimmung nichts Gutes war, schenkte der Navigator allem Raum. Durch diesen Raum zeigte er jedem mit seinem Kompass Wege, die jeder und alles selbstbestimmt nehmen konnte. So fand die Erde ihren Weg um die Sonne, das Wasser durch seine Flüsse in die Meere und die Vögel die Luft. Jedes Lebewesen konnte frei bestimmen, wohin es gehen wollte und was es mit seinem Leben tun wollte. Durch ihn wissen auch wir, wohin wir gehen und was wir am liebsten tun wollen.
So erschufen die drei Götter das Leben.
Ich zog aus dieser Geschichte klare Schlüsse. Niemand wusste zwar, ob es diese Götter wirklich gab, aber für mich hatte das als Kind keine Rolle gespielt. Ich erkannte die Bedeutung sofort. Jeder Mensch musste verstehen, dass alles seine Zeit hatte. Im Kreislauf des Lebens wurden wir geboren und wir verstarben. Die Existenzen galt es zu beschützen, denn alles hatte eine Aufgabe in unserer Welt, egal ob es ein unbedeutend scheinender Vogel war oder ein anderer Mensch. Außerdem waren wir selbstbestimmt. Wir konnten unseren eigenen Weg gehen und das galt es zu beschützen. Diese Weisheit hatte mir viel Kraft und Motivation in meiner Jugend gegeben. Leider – und das bereute ich nachträglich sehr – gerieten solche Geschichten schnell in Vergessenheit. Im Zyklus eines Alltages, in dem es mehrere, verschiedene Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen gab, vergaß man solche Sachen schnell. In meinem Kopf herrschte lange ein unbändiges Chaos, als ich versuchte, all das, was ich gelernt hatte, zu einem sinnvollen Konzept der Welt zu arrangieren. Trotzdem trug ich diese Geschichte als Essenz immer mit mir und versuchte, meiner Außenwelt zu signalisieren, was es zu beschützen galt.
Neben dem Trainingslager, in dem wir Soldatenjünglinge erzogen, trainiert und unterrichtet wurden, fand mein halbes Leben in der Bibliothek statt. Zu schlafen brauchte ich nie lange, angetrieben von meiner jugendlichen Energie hätte ich wochenlang durchmachen können; erwischte mich ehrlicherweise aber immer wieder, wie ich über einem Buch einschlief.
Die Bibliothek war ein Ort des Wohlfühlens. Das Licht, das aus den Oberlichtern in die Halle strahlte, erfüllte alles mit einem merkwürdigen Zauber. Manchmal, wenn ich zu schnell lief, wirbelte ich etwas Staub auf und sah einigen Minuten zu, wie die Körner durch die Luft schwebten und einen sonderbaren Tanz aufführten. Dann nahm ich einen tiefen Atemzug, um nicht nur den wunderbaren Duft der Bücher nach altem Papier und Leder in mir aufzunehmen, sondern auch die Essenz des Wissens in mir aufzusaugen, wie als würde ich allein durch das Einatmen an diesem magischen Ort schlauer werden.
Ich wusste bald, wo welches Buch stand. Dabei waren manche Bereiche interessanter als andere. Wer interessierte sich schon fürs Kochen, wenn man im Trainingslager doch immer nur das essen musste, was einem die Köche vorsetzten? Ich wusste auch, dass in den Bereichen der wertvollen Bücher erst eine Genehmigung eingeholt werden musste, weil diese alten Schriften zu wertvoll waren, um sie mit nackten Händen anzufassen.
So verging einige Zeit, in der ich für die Bibliothek lebte und sie für mich. Wir bildeten bald eine Einheit, die unerwartet Zuwachs erhielt. Unsere symbiotische Einheit bekam eine Erweiterung durch Miraa. Meine Verbindung mit den anderen Soldatenanwärtern war zwar eine gute, aber nie so gut wie zu Miraa. Ich hatte zwar von Freundschaft gelesen, aber gespürt, was es bedeutete, eine zu haben, konnte ich erst durch ihn. Ich war so dankbar, dass ich einen großen Teil meines Lebens mit ihm verbringen durfte.
Ich war gewohnt, dass ab und an auch andere Leute und Gelehrte durch die Bibliothek gingen und Bücher lesen wollten. Es war aber nie so, dass sie auf meinem Radar als wichtig oder besonders erschienen. Wenn ich mich in Bücher flüchtete, schaffte ich es doch erstaunlich gut, alles andere um mich herum zu ignorieren. Doch an jenem Tag konnte ich diesen Kerl, der zufälligerweise in meinem Alter war, nicht ignorieren.
Ich war mal wieder viel zu lange schon in der Bibliothek und wollte gerade nach einem Buch greifen, an das ich mich nicht mehr genau erinnern konnte, welches es war und zur selben Zeit griff auch er nach diesem Buch.
Dann standen wir dort und sahen uns tief in die Augen. Dieser kurze Moment zog sich in meiner Erinnerung bis in die Ewigkeit, bis ich merkte, dass er das Buch ganz vorsichtig zu sich zog und dabei seine Augenbrauen leicht zusammenzog, als müsste er dabei super konzentriert sein. Er war ein Gelehrter, das sah ich an seiner Kleidung; und diese Leute wurden zu diplomatischem Verhalten erzogen. In seiner Reaktion konnte ich jedoch nichts Diplomatisches erkennen und ich hielt das Buch daraufhin fester und zog es an mich heran. Das provozierte ihn und er zog noch fester daran, diesmal mit zwei Händen. Das konnte ich mir nicht gefallen lassen; ich war definitiv der Überzeugung, dass ich viel früher schon das Buch in der Hand gehabt hatte als er. So ging das für einen kurzen Moment, als wir beide wie Irre an diesem Buch zerrten und es sich hin und her bewegte, bis es uns beiden im gleichen Moment aus der Hand glitt und in hohem Bogen davon flog. Er fiel zurück und stieß einige Bücher in dem Regal auf den Boden, während ich beim Zurücktaumeln einige Bücher vom Tisch stieß, die ich dort gestapelt hatte. Es entstand ein riesiges Chaos und ein Krach, der durch die ganze Bibliothek hallte.
Als ich daraufhin energische Schritte hörte, riss es mein jugendliches Selbst, das nicht erwischt und Ärger bekommen wollte auf und ich verschwand. Dabei ließ ich mein Chaos zurück. Ich konnte es mir nicht leisten, unnötig in Probleme zu geraten. Die Konsequenzen, die man als junger Soldat erleiden musste, waren unbeschreiblich schrecklich. Also nahm ich meine Beine in die Hand und rannte los. Ich kannte einige gute, geheime Schlupflöcher und Gänge, die kaum benutzt wurden und bald war ich in sicherer Entfernung. Wäre da dieser Kerl nicht gewesen, der mir gefolgt war.
„Wer zur Hölle bist du!?“, schnaufte ich, als ich eine kurze Pause vom Rennen machen musste. Er war nur eine oder zwei Sekunden hinter mir. Seine Ausdauer beeindruckte mich.
„Das könnte ich dich fragen“, entgegnete er, als er sich kurz vornüberbeugte, um sich auf seine Knie zu stützen. „Ein Soldat in der Bibliothek ist ziemlich ungewöhnlich. Vielleicht sollte ich das melden.“
„Melden? Bist du irre!?“, schrie ich ihn an, musste mich dann aber selbst zurückhalten, um nicht zu laut zu werden. „Du bist mir gefolgt! Du bist jetzt Mittäter, vielleicht sollte ich DICH melden!“
„Ich habe nichts Unrechtes getan!“, warf er mir vor und verzog seine Augenbrauen wieder auf diese merkwürdige Art. „Du hast mir das Buch geklaut!“
„Ich war ja wohl zuerst dran“, beschwerte ich mich.
„Als Gelehrter habe ich immer Vorrechte auf die Bücher gegenüber anderen“, erklärte er und machte dabei eine überhebliche Bewegung mit seiner Hand.
Da hatte er recht und ich wusste das. Also fing ich aus heiterem Himmel an zu lachen, aus tiefstem Herzen. War er mir gefolgt, um mir das zu sagen? War das der Grund? Anstatt mir weitere Vorwürfe zu machen, fing er ebenfalls an zu lachen, anscheinend musste ihm genau der gleiche Gedanke gerade durch den Kopf gegangen sein. Als wir uns beruhigt hatten, lernten wir uns kennen. Wobei es eigentlich gar nicht nötig war, sich kennenzulernen, denn nach den paar wenigen Fragen, die man sich gestellt hatte, wie ‚Wie heißt du? Was tust du?‘ und dieses ganze Gefasel, merkten wir beide, dass wir uns so ähnlich waren, dass so etwas nicht mehr nötig war.
Fortan trafen wir uns täglich und tauschten uns über alle Sachen aus, über die man sich nur austauschen konnte. Das Leben in der Stadt und unsere Berufe, das Leben dort draußen in der Weite und wie dies alles sein musste, Menschen die wir kannten und die uns unbekannt waren, unser Glaube und unsere Sorgen und natürlich unsere größte Leidenschaft, die Bücher. Miraa war ein attraktiver, charmanter Kerl, der dadurch bestach, dass er zurückhaltend-höflich war. Das machte diesen ganzen Charme aus, der ihn umgab. Wenn man ihn sich so ansah, würde man niemals erwarten, dass er ein unfassbar großes Wissen über alles Mögliche hatte. Er war auch ein guter Lehrer; ich war in der Lage, Wissen durch ihn viel schneller aufzusaugen. Dies bewies sich auch dann, als wir später gemeinsam im Geheimen Shiana unterrichteten. Auch sie konnte bezeugen, dass er ein guter Lehrer war.
Es gab nur diese eine Sache, die mich an ihm, abseits von dem unendlichen Vertrauen, das ich zu ihm hatte, störte. Diese unfassbare Bereitschaft dazu, radikal die Veränderung der Welt herbeizuführen, schockte mich jedes Mal aufs Neue. Im Nachhinein wurde mir klar, dass diese Bereitschaft dazu passte, dass er den Kinno-Bujin beigetreten war. Warum musste das so sein? Warum entschied ich mich, als Sohn eines Soldaten, der in einem nicht nennenswerten, unbedeutenden Krieg gefallen war, für einen demokratischen Weg zum Frieden? Und Miraa, der aus einem noblen Hause kam, der nie die Konsequenzen des Krieges hatte erleiden müssen, entschied sich für den radikalen Weg? Ich konnte dieses Problem immer und immer wieder zerdenken, in der Hoffnung, es eines Tages zu lösen. Doch zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob ich es jemals schaffen würde.
Nachdem ich all diese Dinge über Shiana und die Kinno-Bujin erfahren hatte, bewies mir Miraa jedoch, dass das Vertrauen, welches ich in ihn hatte, gerechtfertigt war. Als ich ihn auf die Experimente ansprach, erklärte er mir ausführlich, wie es zu dieser Situation gekommen war. Viel wichtiger jedoch, stellte sich in diesem Krisengespräch, das wir bei mir Zuhause führten, heraus, dass er auch Shiana Loyalität bewies. Miraa erklärte mir, dass die wissenschaftliche Neugier hinter den Geschehnissen anfangs überwogen hatte; durch das Kennenlernen von Shiana und mir, jedoch ein anderes Gefühl die Überhand gewonnen hatte. Ich nahm immer noch an, dass er in Shiana verliebt war; leider konnte ich das jedoch nie beweisen.
Auf die Dinge, die geschehen waren, hatte er nie Einfluss gehabt und deswegen erklärte er mir, dass jetzt der Zeitpunkt kam, wo er Macht über die Entwicklung dieser Operation hatte. Er konnte, dadurch, dass er ein fester Teil des Forschungsteams war, Shiana beschützen. Unter Tränen aufgelöst, zückte er ein Messer und gab mir einen Blutschwur darauf, dass er alles tat, um sie zu beschützen. Ich ging darauf ein und versprach ebenfalls, alles dafür zu tun, damit der Krieg das Land niemals erreichte und es niemals dazu kommen musste, dass Shiana als Waffe verwendet würde. Er schnitt sich tief in die rechte Hand und ich tat es ihm gleich. Wir besiegelten unser Versprechen, indem wir uns die blutigen Hände gaben. Als Soldat wusste ich, dass so ein Schwur nicht nur ein Versprechen war, sondern auch ein Siegel dafür, dass man füreinander starb, wenn es sein musste. Miraa hatte mir mit seinem Leben versprochen, sie zu beschützen. Diesen Höhepunkt unserer Freundschaft würde ich nie vergessen. Vielleicht ließ mich dieser Schwur auch für einige Zeit unsere verschiedenen Ansätze über die Rettung der Welt vergessen.
Teil II
„Wahre Freundschaft ist eine Verbindung zweier Seelen, zweier Schicksale, welche sich in einem festen Knoten unweigerlich überkreuzen. Wie man über diesen Knoten wacht, entscheidet, wie lange dieser hält. “ – Gaara
Und so kam es, dass ich in den Krieg zog. Der Befehl zum Aufbruch kam sehr spontan, was mir wenig Zeit ließ, Vorbereitungen für die Zeit zu treffen, in der ich nicht im Lande war. Ich schrieb Shiana einige Seiten über die Situation, mit der sie hoffentlich etwas anzufangen wusste. Beim Gedanken, sie allein zu lassen, verdrehte es mir den Magen. Jedoch beruhigte es mich zu wissen, dass Miraa sein Leben dafür geben würde, sie zu beschützen. Die Narbe in meiner Hand erinnerte mich jedes Mal daran.
Ich erhielt auf dem Weg zur Front wenig Informationen. Truppen des nordwestlichen Kontinents Kantam und des nordöstlichen Kontinents Benua vereinten sich aufgrund der schwierigen Lage derer Königreiche und suchten in fremden Ländern nach Schätzen und Nahrung. Sie schifften über die Meere und besetzten mehrere Punkte unserer nördlichen Küste. Die anderen Kontinente wie Ueruto im Süden, Kalada, welches an den Nordpol grenzte und die lucdianischen Zwillingskontinente hielten sich aus dieser Auseinandersetzung fein raus. Unsere ruterionischen Königreiche verbündeten sich leider nur teilweise zu einer großen Armee. Nach offiziellen Angaben hatten einige der südlichen Königreiche kaum Truppen, die zur Verfügung gestellt werden konnten; jedoch gab es Gerüchte, dass einige der korrupten Herrscher nicht in diesen Krieg mit hineingezogen werden wollten.
Es geschah also, dass ich den schützenden Wüstengürtel um unseren Stadtstaat verlassen musste, um an der Front die gegnerischen Truppen davon abzuhalten, unsere Königreiche einzunehmen. Unsere Truppe zog mit Kutschen, etlichen Pferden und Fußtruppen durch die Wüste, überquerte die Berge und erreichte nach etlichen Tagen der Reise die Front, welche während der Zeit der Reise nicht hatte gehalten werden könnenund deswegen einige Kilometer näher an meiner Heimat war.
Krieg veränderte alles. Er veränderte die Luft und den Boden, die Sicht auf die Dinge und ganz besonders veränderte er einen selbst. Was blieb von einem Menschen, wenn er auf dem Schlachtfeld stand und ständig den Geruch von verwesenden und verbrannten Kadavern in der Nase hatte, die Hände klebrig vom Blut und den Geschmack von Eisen und Tod im Mund? Der Krieg machte einen zu einem Apparat der Gewalt, der sein Denken ausgelagert und die Verantwortung für die Taten jemand anderem übertragen hatte. Man führte Befehle aus, kämpfte gegen Menschen ohne Gesicht und hoffte, dass die Kameraden nicht fallen würden. Es war schrecklich, einen verletzten Freund über ein Schlachtfeld zu ziehen, um ihn an einen sicheren Platz zu bringen und ihn dort doch nicht retten zu können. Der Blick eines sterbenden Menschen, der mit dem letzten Hauch seiner Seele alles und nichts sagt, während er durch einen hindurch in die Leere des Universums blickt, war etwas, das mich im Schlaf verfolgte. Die Energie wurde aus einem förmlich ausgesaugt, jedoch blieb nie ein Moment, um darüber nachzudenken oder sich schwach zu fühlen.
Die Schlachten waren schrecklich und blutig. Die Verluste auf beiden Seiten waren enorm. Trotzdem schafften wir es, die Front zu halten und nach einigen Kämpfen die gegnerischen Truppen zurückzudrängen. Durch die Erfolge einiger Kämpfe konnte ich mich innerhalb der Truppe als guter Stratege beweisen. Die etlichen Stunden des Lesens und Denkens hatten mir einen Vorteil gegenüber den anderen Soldaten ermöglicht, die nur stumpf die Befehle des Befehlshabers ausführten. Schnell wurde ich zum Truppenleiter ernannt, mit der Aufgabe, eine Sonderoperation durchzuführen. Wir sollten über die Front vorbei ins Lager der gegnerischen Armee gelangen, um sie auszuspionieren. Die Informationen über die dortige Lage sollten uns einen strategischen Vorteil verschaffen.
Eines Tages also, als die Zeit gekommen war – mittlerweile konnte ich die Tage an der Front nicht mehr zählen – schnappte sich meine Truppe ihre Ausrüstung und brach auf, noch bevor der Morgen anbrach. Ich führte die Truppe durch geheime Pfade an der Front vorbei, immer wieder aufmerksam darauf achtend, ob wir entdeckt wurden, oder nicht. Als ich jedoch realisierte, dass wir in einen Hinterhalt gelockt wurden, bevor wir das Lager des Feindes erreichten, war es schon zu spät. Alle Fluchtmöglichkeiten wurden uns abgeschnitten. In einem breiten Tal gefangen, gab es keinen anderen Ausweg, als eine direkte Konfrontation mit dem Feind.
Es geschah alles sehr früh; die Sonne war kurz davor aufzugehen und wir bereiteten uns vor, unser Lager abzubrechen. Der Schutz des Tals gab uns die Sicherheit, dass uns niemand entdecken würde, jedoch wurden wir getäuscht. Die gegnerischen Truppen kamen von fünf verschiedenen Seiten auf uns zu und blockierten jeden Fluchtweg. Sie waren uns zahlenmäßig überlegen, deswegen bauten wir auf eine spezielle kreisförmige Formation, die uns von allen Seiten beschützten sollte. Die Kampftechniken des Gegners waren schnell und brutal und ich musste zusehen, wie ein Soldat nach dem anderen fiel. Meine Leute konnten keine großen Siege verbuchen, doch wir kämpften verbittert bis zum Ende. Ich kämpfte mit allem, was ich hatte und entdeckte dabei mein besonderes Potenzial. Als ich der letzte Mann meiner Truppe auf dem Schlachtfeld war, erkannte ich, welch enorme Kraft in mir wach wurde. Ich entwickelte eine Technik, die später den Namen Genkioken erhalten sollte. Die Kraft in mir kanalisierte und konzentrierte sich in meinen Händen. Die Energie war dabei so stark, dass Flammen aus meiner Hand züngelten und mir gelang es, diese magische Kraft auf meine Feinde zu schleudern. Mehrere Gegner fielen, während ich mir meinen Weg zur Flucht bahnte. Im Anbruch des Tages schien die Hälfte der umzingelten Truppen zu Fall gegangen zu sein und ich schien mir meines alleinigen Sieges sicher. Die Feinde waren beeindruckt von meiner Standfestigkeit und arrangierten sich immer wieder zu neuen Formationen, deren Angriffe ich manchmal nur glimpflich entkommen konnte. Sie jagten mich, verfolgten mich und griffen mich über den Zeitraum eines Tages immer wieder an. Gerade, als ich glaubte, einen Moment zur Ruhe zu kommen, um meine Kräfte zu sammeln, geschah ein neuer Angriff. Schnell realisierte ich die Strategie, die sie umsetzten. Es griffen immer nur kleine Gruppen an Männern an, die sich flott zurückzogen, wenn ich wieder die Oberhand im Kampf erlangte. Sie verfolgten mich, ganz gleich, wohin ich flüchtete. Dies musste bedeuten, dass sie darauf bauten, dass ich sie zu meinem Lager führen würde, aber das ließ ich nicht zu. Ich begab mich also nicht direkt zu meinem Lager, sondern versuchte, die Situation wieder zu meinen Gunsten zu verändern, sodass sie niemals im Lager ankommen würden. Gegen kleine Gruppen zu kämpfen, war nicht das Problem. Es schien, als wäre meine Ausdauer bald zum Ende gekommen. Zumindest ließ ich sie im Glauben daran und ließ mich erschöpft auf einem Feld nieder. Das Leichteste wäre es nun für den Feind, mich gefangen zu nehmen und so lange zu foltern, bis ich den Standort des Lagers preisgäbe. Dass dies keine Option für mich darstellte, stand außer Frage. Ich ließ die restlichen Truppen der Feinde näherkommen und wollte sie in einen letzten Kampf verwickeln.
Sie stürmten alle mit ihrer siegessicheren Überheblichkeit auf mich zu. Wie ein Tsunami brachen die Schatten auf mich nieder und ich ließ den Angriff zu, um meine letzten Kraftreserven zu aktivieren. Die Kraft, die durch meinen Körper floss, sammelte sich im Inneren und explodierte förmlich, als die Angriffe über mich hereinbrachen. Die Energie züngelte in Flammen aus meinen Händen und nun auch aus meinen Armen und ließ mich mit einer mächtigen Druckwelle all meine Gegner von mir davonschleudern. Wie in Trance stand ich auf und gab jedem einzelnen Mann auf dem Schlachtfeld den Rest. Ich konnte mich nur verschwommen an die Geschehnisse erinnern, denn als mir die Kraft ausging, fiel ich bewusstlos zu Boden. Erst, als ich nach einer unbekannten Zeit wieder zu Sinnen kam, stellte ich fest, dass ich diese Schlacht allein gewonnen hatte. Schwach kroch ich über den staubigen Boden, auf der Suche nach etwas Essbarem und etwas zu trinken. Ich kam an einen Bach und trank viel Wasser; erst danach wusch ich mir das Gesicht und die Hände, die vor Blut und Dreck klebten. Ich sammelte Kraft, stand auf und analysierte die Lage. Als ich feststellte, dass mir keine der feindlichen Truppen auf den Fersen war, entschied ich mich dafür, mein Lager aufzusuchen.
Allein wanderte ich durch die Landschaft und fühlte mich so schlimm wie noch nie. Jeder einzelne Soldat meiner Truppe war gefallen und ich als Einziger hatte diese schreckliche Schlacht überlebt. Obwohl es still war, hallten durch meine Gedanken die Schreie der Männer, die ihr Leben gelassen hatten. Schwach kam ich an dem Ort an, an dem einst das Lager gewesen. Niemand war mehr dort; nur ein paar Tote bewiesen, dass hier wohl gekämpft worden war. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Was war hier geschehen? Ich durchsuchte die Überreste des Lagers nach Verpflegung und fand einige Sachen, die ich zu mir nehmen konnte.
Im Falle, dass die gegnerische Armee die Front durchbrach, gab es den sofortigen Befehl, die Lager abzubrechen und sich neu zu formatieren. Einerseits gab es diesen Plan dafür, die Reserven aufzustocken und die Verletzten zu pflegen und andererseits, um den Kern unseres Königreiches zu schützen. Sie mussten also alle auf dem Weg zurück sein. Konnte ich sie einholen?
Nach drei Tagen einsamer Wanderung entdeckte ich ein kleines Lager, welches von unseren Soldaten zurückgelassen worden war. Ich erkannte das an der kaputten Ausrüstung, welche ich dort fand. Zu meinem Glück entdeckte ich ein Pferd, welches sich mit seinem Geschirr in einer Gruppe kleiner Bäume verfangen hatte und nicht fliehen konnte. Es schien ihm gut zu gehen, also befreite ich das Pferd aus seiner Gefangenschaft und freundete mich mit ihm an, indem ich ihm etwas zu fressen gab. Das war die Chance für mich, meine eigene Truppe einzuholen. Ich schwang mich auf das Pferd und ritt los. Ich war am Ende meiner Kräfte. Einmal passierte es mir, dass ich einschlief und vom Pferd fiel. Verletzt lag ich im Gebüsch. Das Pferd bemerkte dies sofort und kam zu mir zurück. Es war unglaublich, wie fürsorglich es nach mir suchte. Obwohl ich starke Schmerzen hatte, stieg ich wieder auf, riss mich zusammen und führte meine einsame Reise nach Hause fort.
Und in diesen einsamen Stunden, in denen ich darauf fokussiert war, nach Hause zu kommen, kam es mir in den Sinn. Was, wenn die gegnerischen Truppen schon längst die Stadt einnahmen? Was, wenn Shiana schon längst zur Waffe geworden war? Was, wenn wir schon längst verloren hatten? Ich durfte nicht zulassen, dass diese düsteren Gedanken zu Gift wurden – Gift, welches meinen Verstand zerstörte. Ich durfte die Hoffnung auf keinen Fall verlieren; es gab sicher noch Wege, alles zu retten. Die Zeit verging kaum, als ich darüber nachdachte, was am Besten zu tun war. Ich dachte über den Feind nach, über ihre Beweggründe und warum sie unseren Reichtum wollten. Ich dachte darüber nach, eine friedliche Einigung zu finden und ich dachte über Shiana nach. Miraa hatte mir geschworen, sie unter dem Einsatz seines Lebens zu beschützen. Jedoch durfte ich ihn mit dieser Bürde nicht allein lassen. Also trieb ich das Pferd bis zu seinen Grenzen und erreichte bald die Wüste. Am blutroten Horizont stiegen Rauchschwaden auf. Vielleicht gelang es mir im Schutze der Dunkelheit, die Front zu durchbrechen und die Stadt zu erreichen. Ich musste wieder kämpfen.
Es schien alles so leicht zu sein. Ich fand meinen Weg durch die Wüste, aß an einer Oase ein paar Früchte, um zu Kräften zu kommen und fand durch eine Route, die von Osten her zur Stadt führte, sicheren Zugang zu ihr, ohne vom Feind entdeckt zu werden. An der Front war es diese Naht ruhig; ich sah von einer Düne aus etliche Lager, die sich bis zum Horizont erstreckten. War die Ruhe, die in dieser Nacht herrschte, die bekannte Ruhe vor dem Sturm?
In der Stadt angekommen, erkannten mich die Wachen und ließen mich passieren. Sie munkelten von Gerüchten über mich, doch ließ ich ihre Worte nicht bis zu mir durchdringen. Es gab Wichtigeres zu tun, als dem Geschwätz von irgendwelchen Wachen zu lauschen. Also ging ich auf direktem Wege zu meiner Wohnung, nahm aus meinem Versteck alle wichtigen Unterlagen, die ich sorgfältig verborgen hatte, ging dann zu Miraas Wohnung und stieg durch sein Fenster. Er lag in seinem Bett und schien seelenruhig zu schlafen, trotz der Lage vor den Stadttoren. Ich weckte ihn und es überraschte ihn, mich zu sehen.
Miraa sah anders aus. Er hatte sich verändert, so wie ich mich scheinbar verändert hatte, denn dies schien er auch an mir zu beobachten. Wir sprachen kein Wort; er verstand sofort, was ich von ihm wissen wollte und sein Gesichtsausdruck erzählte mir alles. Bitterkeit und Trauer drangen aus seinen Augen. Hatte er aufgegeben? Ich wandte mich zum Gehen und bevor auch nur ein Wort seine Lippen verließ, sprang ich schon aus dem Fenster und stürmte zu Shiana.
Teil III
„An manchen Tagen fühlte ich mich, wie orientierungslos durch den Raum zu schweben. Erst dieses Licht gab mir eine Richtung, einen Anker und eine Orientierung. Das Licht war zu meiner Sonne geworden.“ – Gaara
Wie immer stahl ich mir eine Leiter aus dem Schuppen in der Nähe ihres Fensters und kletterte hinauf. Ich stieg durch das Fenster und stand in ihrem Raum. Die Luft bewegte sich kaum und es war ein besonderer Duft wahrzunehmen; er war etwas süßlich und angenehm. Es war schön, zur Abwechslung einmal keine verbrannten Körper zu riechen.
Dort lag sie, in ihrem Bett und schlief. Auch sie schien sich verändert zu haben; das spürte ich augenblicklich. Selbst jetzt, als sie sich kaum bewegte und ihr Bewusstsein in fernen Träumen schwebte, strahlte sie eine immense Energie von ihrem Körper ab, die mich beeindruckte. Ich verweilte zunächst ein wenig; immer wieder über die gleichen Gedanken stolpernd, doch zwang ich mich dazu, endlich mit ihr zu sprechen. Ich weckte sie und signalisierte ihr, dass sie still bleiben sollte. Sie musterte mich und erkannte, dass ich ein anderer Mann geworden war, als damals, als ich sie in Miraas Schutz hatte zurücklassen müssen. Bis zu diesem Augenblick schien er sein Versprechen gehalten zu haben. Ihr ging es gut; doch die sich nähernde Gefahr lud die Aura um uns auf und elektrisierte die Luft zwischen uns. Ich wollte ihr so gerne sagen, dass sie fliehen sollte, sodass sie die Schrecken dieses Krieges niemals würde sehen müssen. Doch Shiana schien zu verstehen, dass der Krieg nun die Stadt erreicht hatte und blickte mit diesem Wissen und ihren unfassbar schönen, blauen Augen selbstbewusst in meine. Ich schluckte und legte mir die Worte im Kopf zurecht.
„Sie werden dich als Waffe verwenden“, sprach ich, im klaren Bewusstsein darüber, dass Miraa mir das hatte mitteilen wollen.
„Ich weiß. Wir werden uns wehren“, antwortete sie. Hatte sie mittlerweile Kontakt mit den anderen erlangt? Hatte sie wirklich vor, in den Kampf zu ziehen?
„Wir?“, fragte ich neugierig nach, um mehr darüber zu erfahren.
„Ich habe die anderen kennengelernt. Wir haben viel trainiert“, erklärte sie kurz und ich verstand. Ich warf einen vorsichtigen Blick aus dem Fenster und sah in der Ferne die Gefahr.
„Die Front ist hier. Ich wurde zurückgezogen, nachdem ich an etlichen Fronten die gegnerische Armee immer wieder abgewehrt habe. Sie wollen, dass ich den morgigen Einsatz hier leite“, log ich, um sie in Sicherheit zu wiegen. „Die Stadt darf nicht fallen. Hier leben so unfassbar viele unschuldige Menschen, die mit diesem Krieg nichts zu tun haben. Wir müssen dem Krieg ein für alle Mal ein Ende bereiten.“ Ich musste schnell einen Weg finden, die ganze Sache zu beenden, bevor Shiana in den Krieg ziehen musste.
„Wir kämpfen ebenfalls“, sagte sie mit ihrer ruhigen Stimme. Ihre blauen Augen strahlten durch die Dunkelheit der Nacht und hielten mich für einen Augenblick gefangen.
„Das dürft ihr nicht. Sie werden eure Macht missbrauchen“, forderte ich, doch sie schien nicht zu verstehen.
„Nein, das werden sie nicht“, erwiderte sie. „Wir haben einen Plan geschmiedet.“
Sie erklärte mir ihr Vorhaben mit allen Details und ich war erstaunt über ihre strategischen Fähigkeiten, die einem Oberst auf dem Schlachtfeld glichen. Ich war nicht in der Lage, zu diesem Zeitpunkt auch nur eine Schwachstelle ihres Planes festzustellen, was wahrscheinlich an meiner unfassbaren Müdigkeit lag. Dennoch hatte ihr Plan einen merkwürdigen, bitteren Beigeschmack, den ich mir erst später erklären konnte.
„Das ist viel zu riskant“, zweifelte ich und nahm ihre Hände. „Dir wird etwas passieren.“
„Anderen wird etwas Schlimmeres passieren, wenn wir nicht handeln. Wir haben eingesehen, dass wir eine Macht haben, die keiner mit uns teilt. Diese Macht wird uns helfen, Dinge zu verändern. Ich habe Laan und Ea von der Welt erzählt, die du mir geschildert hast. Wir haben die Fähigkeit, all dem Bösen ein Ende zu setzen und allen Menschen eine Welt zu ermöglichen, die so schön ist, wie du sie mir einst beschrieben hast.“
Als sie das sagte, sah ich ihr noch einmal tief in die Augen und ihr Selbstbewusstsein schien nur stärker zu werden.
„Ich werde dich nicht abhalten können, richtig?“, zweifelte ich.
Sie schüttelte nur verneinend ihren Kopf und nahm meine Hand noch fester. Für einen kurzen Moment schien es, als wollte sie mich retten, obwohl ich doch sie vor allem Übel der Welt retten wollte.
„Wir werden uns morgen auf dem Schlachtfeld sehen“, verabschiedete ich mich und stieg wieder aus dem Fenster. „Pass auf dich auf.“
„Du auch auf dich“, verabschiedete sie sich ruhig.
Als ich die Leiter hinabstieg, sie abbaute und wieder versteckte, blieb noch eine Person übrig, die ich besuchen musste, um diesem Krieg Einhalt zu gebieten: der König.
Meine Beziehung mit dem König war merkwürdig. Als junger Soldat wurden meine Kumpane und ich oft als Schutzwachen für die diplomatischen Treffen des Königs eingesetzt. Wir liefen oft seiner Kutsche hinterher, bewachten die Orte, an denen der König andere wichtige Persönlichkeiten traf und achteten darauf, dass ihm keiner zu nahe kam. König Soreiyuu wirkte dabei immer sehr weise, höflich, zuvorkommend und lustig auf mich. Er hatte eine besondere Macke: Wenn er mit anderen Diplomaten sprach, verzichtete er nie darauf, die meist schwierigen, politischen Situationen in den ersten Minuten des Gesprächs mit Scherzen und Witzen aufzulockern. Ich erinnerte mich, dass ich einst meine Position als Wache im Raum mit der vor der Tür hatte austauschen müssen, weil ich mir das Lachen nicht hatte verkneifen können. Als Soldat ging es immer darum, ein starkes, neutrales Gesicht zu wahren. Von meinem Truppenführer bekam ich an diesem Tag eine dicke Strafe aufgebrummt, obwohl der König nach dem Treffen befahl, dass ich ihn zurück zum Schloss begleiten sollte, sodass er mir etliche andere Witze erzählen konnte.
Es geschah so oft, dass ich den König persönlich begleiten sollte, dass ich rückblickend nicht sagen konnte, ob wir nun eine gute Beziehung hatten oder ob ich einfach ein Soldat war, dem er Witze erzählen konnte.
Ich eilte nun zum König; meine ausgezeichneten Kenntnisse über das Schloss und dessen Aufbau führten mich an einigen Wachen vorbei, durch Gassen, die keiner kannteWir waren den Aufbau des Schlosses immer wieder durchgegangen, damit im Falle des Falles jede wichtige Person darin in Sicherheit gebracht werden konnte. Vielleicht mussten diese Gassen schon bald dazu verwendet werden, den König in Sicherheit zu bringen.
Schließlich kam ich durch eine versteckte Tür ins Schlafgemach des Königs. Das Geräusch der schließenden Tür weckte ihn; er stützte sich in seinem Bett auf und sah durch den wenigen Kerzenschein des Raumes mich dort stehen.
„König, Ihr müsst mir zuhören“, sprach ich direkt und kam ihm nur ein paar Schritte näher. Ich sah, dass er mich als Soldat erkannte und hielt einen respektvollen Abstand zu ihm.
„Soldat, was machst du in meinem Schlafgemach?“, wunderte sich der König, der sich nun richtig aufsetzte und sich einen Morgenmantel überwarf.
„Mein Name ist Gaara Sabekaze. Oft schon habe ich als Soldat als Ihre Wache gedient und wurde für den Krieg eingezogen. Meine Einheit starb an der Front; durch ein Wunder überlebte ich und bin nun zurückgekehrt“, erklärte ich.
„Und was willst du von mir?“, fragte der König, wobei er nicht verärgert, sondern nur verwundert klang. „Melde dich beim Oberst zum Dienst.“
Ich schüttelte den Kopf und hob erklärend meine Hände. „Ihr müsst verstehen, dass mein Anliegen von wichtigster Bedeutung ist.“
Der König stand auf, zündete noch eine Kerze an und erkannte im nun stärkeren Licht, wie ich aussah. Ehrlicherweise hatte ich bisher keine Gelegenheit gehabt, mich ordentlich zu waschen. Es fühlte sich unangenehm an, meinem König so vor die Augen zu treten. Ich schmeckte plötzlich den Schweiß auf mir und den Dreck auf meinen Lippen.
„Die Kinno-Bujin werden, sobald die feindlichen Gruppen in die Stadt gelangen, etwas Schreckliches tun“, erklärte ich und ich sah, dass der König plötzlich einen neugierigen Gesichtsausdruck hatte. Die Kinno-Bujin waren eine geheime Organisation, die nur der König und der Oberst kannten; das hatte ich herausgefunden.
„Soldat, woher weißt du von den Kinno-Bujin?“, hakte der König nach.
„Ich weiß, dass die Kinno-Bujin Experimente an Straßenkindern durchführten, um Waffen herzustellen“, sagte ich nüchtern. Ich wollte es so lange wie nötig geheim halten, dass ich Shiana kannte.
„Die Kinno-Bujin sind eine geheime Wissenschaftsdivision“, entgegnete mir der König und hielt für einen Moment inne, um nachzudenken. „Sie stellen keine Waffen her.“
„Wenn Ihr erlaubt“, bat ich, kramte aus meiner Tasche die Unterlagen, die ich mir von zu Hause mitgenommen hatte und zeigte ihm die ganzen Aufzeichnungen, die ich über die Experimente an Shiana, Laan und Ea erstellt und gefunden hatte. Ich trat wieder einen Schritt zurück und ließ den König sich die Unterlagen im Kerzenschein betrachten. Er war die einzige Person, die den Einsatz von Shiana als Waffe noch verhindern konnte. Sie war unschuldig und durfte an diesem Krieg nicht teilhaben.
„Was bei der Jugend wie Unerbittlichkeit aussieht, ist meistens Aufrichtigkeit“, rezitierte ich den König. Diesen Spruch hatte er mir einst gesagt, als Antwort auf mein Lachen. Ich hoffte, dass es der König unterband, dass die Kinno-Bujin ihre Waffen verwenden durften.
„Wenn dies der Wahrheit entspricht“, erklärte der König und wandte seinen angstvollen Blick nicht von den Unterlagen ab, „dann rettest du hiermit unser Königreich. Wenn das öffentlich wird, verlieren wir unser Gesicht und all unsere diplomatischen Beziehungen. Wir sind keine Eroberer; es handelt sich hier schließlich um einen Verteidigungskrieg. Wie war dein Name, Soldat?“
„Gaara, mein König“, stellte ich mich noch einmal vor.
„Es muss etwas dagegen getan werden“, sprach er.
Doch er konnte nicht weitersprechen. Eine immense Explosion am Rande der Stadt ließ den Schlossturm erzittern. Sofort stürmte er zum Fenster, um sich ein Bild der Lage zu machen. Fast gleichzeitig wurden die großen Türen des Schlafgemachs aufgerissen und der befehlshabende Oberst trat herein, um den König zu warnen.
„Mein König, der Feind ist in die Stadt eingedrungen!“, erklärte er erschüttert und der König ließ seinen Blick nicht von den Rauchsäulen ab, welche das Licht der aufgehenden Sonne verdeckten.
„Wir müssen Euch hier herausbringen!“, befahl der Oberst und einige Soldaten kamen in den Raum, welche mich alle verdutzt betrachteten. Mir waren meine einstigen Kollegen gerade jedoch egal. Ich brauchte eine Antwort über den Kampfeinsatz Shianas, sonst würde ich dem König nicht von der Seite weichen, bis er eben diese Entscheidung getroffen hatte.
„König“, sprach ich und kassierte dafür einen bösartigen Blick des Oberst, als hätte ich gerade alle Regeln eines Soldaten gebrochen.
Nun wandte sich der König zum Oberst und wedelte vor seinen Augen mit den Unterlagen umher.
„Entspricht das etwa alles der Wahrheit? Die Kinder sind Waffen!?“, warf er erzürnt dem Oberst vor. „Du musst diesen Kampfeinsatz mit sofortiger Wirkung abbrechen!“
Der Oberst sah sich die Unterlagen an und warf dann mir einen Blick zu. Dieser Blick zeigte das kalte Entsetzen des Oberst und ich erkannte, dass er von allem wusste. Er hatte den ganzen Experimenten zugestimmt und befehligt, dass die Kinder als Waffen eingesetzt werden sollten. Nun war das alles aufgeflogen. Was der König ihm noch alles an den Kopf warf, hatte ich nicht mitbekommen, weil ich wieder so in Gedanken versunken war.
Der Oberst schüttelte den Kopf. „Es ist zu spät; der Einsatz hat mit dem Eindringen des Feindes begonnen. Die Kinno-Bujin sind nun eine weitere Kampfeinheit in diesem Krieg. Sie werden das Königreich verteidigen.“
Als diese Aussage fiel, brodelten in mir alle Emotionen auf und ich nahm meine Beine in die Hand. Vorbei an den Soldaten, die noch versuchten, mich aufzuhalten und zur Rede zu stellen, wandte ich dem König den Rücken zu und rannte durch das Schloss. Ich musste Shiana finden und sie vor diesem Kampf beschützen.
Teil IV
„Verteidigen, Erobern, Angreifen, Erweitern. Das alles und noch so viel mehr waren schlecht Entschuldigungen für wesentlich schlechtere politische Entscheidungen. Krieg war niemals zu entschuldigen. “ – Gaara
In diesen Minuten des Suchens liefen die schlimmsten Szenarien vor meinem inneren Auge ab, die ich mir nur hätte ausdenken können. Jedes dieser Bilder zeigte mir Shiana, wie sie nur auf die erdenklichste Art und Weise entstellt war, badend in ihrem eigenen Blut, thronend auf einem Berg von Leichen. Mein Herz wurde von einem stechenden, brennenden Schmerz durchzogen, als diese Bilder, eines dem nächsten stark ähnelnd, immer und immer wieder meinen Geist vernebelten.
Ich musste sie finden, so schnell es ging und sie davon abhalten, ihren Plan umzusetzen.
Nun rannte ich also durch die Gassen der Stadt, den Geräuschen des Kampfes hinterher. Mittlerweile gab es an verschiedenen Ecken Erschütterungen, die signalisierten, dass der Feind nun schon an mehreren Orten in die Stadt eingedrungen war. Immer wieder rannten Soldatentruppen an mir vorbei. Ich erkannte einige meiner alten Kumpane, die nun ihr Leben lassen durften, um dieses Königreich zu beschützen. Das, was einem als Soldat die Kraft gab, überhaupt in den Kampf zu ziehen, war die Hoffnung, dass der Krieg niemals die Heimat erreichte. Doch das Gefühl, die Sicherheit zu haben, dass nach den Kämpfen – egal ob verloren oder gewonnen – die Heimat nie wieder so sein würde, wie man sie als Erinnerung im Herzen trug, war unbeschreiblich schrecklich.
Das Zittern meines Körpers ließ mich langsamer werden. Mir kamen feindliche Truppen entgegen; ich zückte meine Waffe und kämpfte gegen einige der Gegner, dass sie nicht mehr vom Boden aufstanden und nahm weiter meine Suche auf, Shiana zu finden. Doch es war vergebens. Nirgendwo gab es ein Anzeichen darauf, wo sie oder Mitglieder der Kinno-Bujin hätten sein können. Bis zu einem besonderen Augenblick.
Über den Dächern der Stadt stieg ein Staubwirbel auf, der auf einen Schlag zu einer Lichtsäule wurde, die bis in den Himmel reichte. Ich konnte mir nie wirklich erklären, warum, aber ich wusste mit absoluter Sicherheit, dass diese Lichtsäule etwas mit Shiana zu tun hatte. Über einen Karren mit Obst stieg ich auf ein Vordach von einem Haus und kletterte auf dieses hinauf. Mein Herz pochte enorm, als ich versuchte, mir eine Übersicht über die Lage zu machen. In der Nähe des Schlosses gab es einen großen Festplatz, von dem die Lichtsäule zu kommen schien. Ich konzentrierte meine Kraft und sprintete los, sprang von Dach zu Dach. In diesem Viertel gab es eigentlich nur Lehmhäuser mit flachen Dächern, was es mir erleichterte, direkt zum Festplatz zu kommen.
Als ich näherkam, sah ich drei Lichtpunkte; einen roten, einen grünen und einen blauen, die umringt von Feinden und den Kinno-Bujin im Zentrum des Platzes standen. Erst jetzt erkannte ich, was es bedeutete, dass Shiana, Ea und Laan trainiert hatten. Bevor ich vom Dach sprang, um zu Shiana zu kommen, verweilte ich für einige Sekunden dort, um zu sehen, wie sie kämpften. Laan war ein starker Nahkämpfer, der mit kräftigen Faustschlägen und Tritten seine Gegner weit von sich wegschleudern konnte. Ea hielt ein Schwert in seinen Händen, welches ständig seine Form änderte; er bezwang damit jeden bewaffneten Feind und streckte sie zu Boden. Besonders fand ich jedoch, wie Shiana kämpfte. Ihre Hände fingen an zu leuchten und plötzlich spannte sich ein Lichtbogen darin, mit dem sie Pfeile aus purem Licht auf ihre Gegner schießen konnte. So schafften es die drei, ihre Gegner schön auf Abstand zu halten.
Endlich fasste ich den Entschluss, herabzuspringen und auf Shiana zuzugehen. Unten angekommen, stand ich wieder auf und sprintete auf das Schlachtfeld zu.
Ich bahnte mir einen Weg durch die Feinde, entwaffnete dabei einige von ihnen mit meinem Speer und tötete sie, sodass sie blutend zu Boden gingen und als Exempel für ihre Brüder galten. Als ich es endlich schaffte, mich zum Zentrum des Platzes vorzukämpfen, sah ich sie vor mir stehen. Shiana stand dort und hielt für einen Moment inne; unsere Blicke trafen sich. Sie war nicht wie sonst in ein feines Kleid gekleidet, sondern hatte diesmal eine praktische Ausrüstung an, die meiner sehr ähnlich war. Protektoren beschützten Schultern, Arme und Beine. Jedoch fehlten bei ihr jegliche Halterungen für Waffen. Sie sah mir direkt in die Augen und es war, als würde sie zu mir sprechen, ohne Worte zu verwenden. Es schien, als wäre ihr Entschluss gefasst und als könnte ich sie nicht aufhalten. Gab es noch eine Chance, sie vor Schlimmerem zu bewahren? Hatte ich die Möglichkeit, sie zu beschützen?
Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, sprang mir ein feindlicher Soldat auf den Rücken und würgte mich. Ich griff nach seinen Armen, während ich versuchte, Luft zu bekommen und mir fiel nichts anderes ein, als zu ihn zu beißen. Er schrie auf, aber nicht wegen meines Bisses, sondern, Shiana schon längst einen ihrer Lichtpfeile auf ihn abgeschossen hatte und er verletzt zu Boden sackte. Ich erkannte, dass seine Schulter an der Stelle, wo ihn der Pfeil getroffen hatte, Verbrennungen aufwies. Ich hob meine Waffe auf, die ich hatte fallen lassen und stellte mich dem nächsten Kampf. Sogleich fand ich einen rosahaarigen jungen Mann neben mir, der ebenfalls wie Shiana in Ausrüstung, aber mit einem besonderen Schwert kämpfte; es war Ea. Die Klinge seines Schwertes veränderte sich mit einem Lidschlag von Metall zu Feuer. Ea nickte mir zu und beide stürzten wir uns in den Kampf. Gekonnt wirbelte ich meinen Speer um mich herum und schaffte es dabei, einige Gegner zu entwaffnen. Den Moment der Entwaffnung nutzte ich immer aus, um mit dem stumpfen Ende meiner Waffe so in die Magengegend zu schlagen, dass die Gegner nach Luft röchelnd wegtaumelten. Durch die Masse an Menschen hindurch sah ich, dass die feindlichen Truppen einige Heiler mitgebracht hatten, die sich immer sofort um ihre Leute kümmerten.
Ea hielt mit seinem Flammenschwert seine Feinde schön auf Abstand. Kam ihm doch einer zu nah, änderte die Klinge wieder ihre Form und Ea schlug unter anderem mit einem Hammer aus Stein zu oder schreckte seine Feinde mit einer stacheligen, kristallinen Form ab. Er war fast unberührbar. Wer jedoch wirklich unberührbar schien, war Laan. Immer wieder schnellte der Junge mit den grünen Haaren nach vorn und schlug seine Feinde ohne Waffe in die Flucht. Ich hatte einmal ein paar Sekunden Zeit, seinen Kampfstil genauer zu beobachten und stellte fest, dass, egal wie viele Personen sich auf ihn stürzten, ihn tatsächlich keiner berührte. Wie, als hätte er eine unfassbare Abstoßungskraft, schleuderte es die Gegner teilweise wie von selbst von ihm weg. Immer, wenn er mit seiner Faust zuschlug, erkannte ich, dass für eine kurze Zeit ein grünes Licht aufleuchtete und sah ein merkwürdiges Würfelgitter um seine Fäuste aufleuchten.
Als jemand von hinten an ihn herankam, schnellte ich zu ihm und brachte den Feind mit meinem Speer zum Stolpern. Während der Mann in der Luft zu schweben schien, drehte sich Laan tänzerisch zu dem Mann und verpasste ihm einen so starken Schlag in die Magengegend, dass er von uns weggeschleudert wurde. Wie in Zeitlupe sah ich den Mann einige Meter durch die Luft fliegen. Ich war fasziniert von der Stärke, welche die drei zeigten.
Der Kampf schien nicht enden zu wollen. Immer wieder strömten die gegnerischen Truppen – welche von allen Kontinenten stammten – auf das Kampffeld. Ich erkannte uerutoische, benuanische und kantamische Truppen. Ich erkannte Krieger aus Lucdia und Kalada und fing an, mich zu wundern, was der Grund war, dass Krieger von allen Kontinenten in unser Königreich eindrangen und kämpften. Was verbündete die Feinde, von denen ich wusste, dass etliche diplomatische Beziehungen zwischen ihnen schon vor Jahrzehnten auseinandergebrochen waren? Was brachte die Welt dazu, uns anzugreifen?
Kalter Schweiß brach mir aus, als ich mich umdrehte und die Antworten direkt vor mir hatte. Sie wollten die Macht von Shiana, Ea und Laan. Sie wollten diese Kräfte nutzen, um was weiß ich mit ihnen anzustellen. Nun stand ich für einige Sekunden da, den Kampf im Rücken und blickte auf den schwertschwingenden Ea, den kämpferischen Laan und Shiana, welche einen Pfeil nach dem anderen abschoss. Ich vergaß den Schmerz, der mir durch die Glieder fuhr, den schweren Atem und die unbeschreibliche Hitze und betrachtete die drei. Ich musste mir vorstellen, wie sie ein normales Leben führten, in einer normalen, friedlichen Welt. War es das, was ich für Shiana wollte? Ein normales Leben? Wie hielt ich sie von ihrem Plan ab?
Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als eine Silhouette erschien, die ich erst nicht richtig deuten konnte, da mir etliche aufwirbelnde Staubwolken die Sicht versperrten. Ich bemerkte nun auch, dass mir Blut über das Auge lief; es schien, als hätte mich jemand im Kampf im Gesicht verletzt, ohne dass ich es bisher bemerkt hatte. Als die Silhouette näherkam, sah ich Miraa auf dem Kampffeld stehen und ich wusste, dass das nichts Gutes bedeuten konnte. Hinter ihm befand sich eine Spezialeinheit der Armee – die Kinno-Bujin. Sogleich stürmten die Mitglieder der Kinno-Bujin los und versuchten, die gegnerischen Truppen zurückzudrängen. Ich rannte durch die Menge und packte Miraa an der Schulter.
„Miraa, das muss aufhören! Sofort!“, verlangte ich flehend von ihm und sah ihm dabei ins Gesicht. Der Blick, den er mir zuwarf, ließ einen eiskalten Schauer durch mein Rückgrat fahren.
„Gaara, wir können es endlich schaffen“, grinste er mich an. „Wir haben endlich die Chance, die Welt zu verändern!“
Miraa wirkte fast so, als würde er wie ein kleiner Junge jubeln. Sein Blick und Grinsen; das war nicht er, das erkannte ich sehr früh. Jedoch realisierte ich erst viel später, was das zu bedeuten hatte. Ich ließ nicht von seiner Schulter ab und packte ihn noch stärker.
„Was meinst du damit!?“, forderte ich, von ihm zu erfahren.
Als er antwortete, sah er mir direkt in die Augen und zögerte keinen Moment, mir die Wahrheit zu erzählen. „Der König hat mich zum Chef der Kinno-Bujin ernannt! Und ich habe es in der Hand, Gaara! Sieh dir doch diese drei Götter an, mit denen wir die Welt erneuern können!“
„Du bist wahnsinnig!“, brüllte ich und ließ ihn dabei nicht los; wissend, was für eine Bedeutung seine Wörter hatten. Doch er versuchte jetzt mit einer Handbewegung, sich aus meinem Griff zu befreien. „Shiana ist auch deine Freundin!“
„Nein“, sprach er und lachte dabei, während sich seine Augen zu engen Schlitzen zusammenzogen. „Sie ist eine Göttin! Schau dir doch an, mit was für einer Macht sie ihre Gegner niederstreckt! Sieh doch, Gaara. Unser Traum wird endlich wahr! Wir können eine Zukunft schaffen, in der es jedem gut geht.“
Das war nicht unser Traum, wiederholte ich immer wieder in meinem Kopf. Ich warf einen kurzen Blick zurück aufs Schlachtfeld und beobachtete, wie Ea Shiana vor einem Angriff schützte und auch Laan blitzschnell dazustieß. Zu dritt kämpften sie weiter. Miraa hörte nicht auf zu lachen und ich wusste, dass dieser Krieg kein gutes Ende nehmen würde. Meine Faust ballte sich zusammen und ohne, dass ich darüber nachdenken konnte, verpasste ich Miraa einen harten Schlag ins Gesicht. Ich wollte, dass es aufhörte. Ich wollte, dass das Morden, die Kämpfe und die Experimente an unschuldigen Kindern aufhörten.
Ich sah zu, wie Miraa einige Schritte nach hinten taumelte und wieder einen sicheren Stand fand. Er hob seine Hand, um die Stelle in seinem Gesicht abzutasten und um sie auf Verletzungen zu untersuchen. Er stellte fest, dass noch kein Blut über sein Gesicht floss und als er realisierte, was ich soeben getan hatte, warf er mir einen entsetzten Blick zu. Ich bemerkte erst einen Moment später, dass die Faust, mit der ich zugeschlagen hatte, enorm zitterte. Es war der Moment, in dem unsere Freundschaft zerbrach. Das wusste ich aufgrund des bitteren Geschmacks auf meiner Zunge, meiner Sicht, die durch Tränen unscharf wurde und das vorwurfsvolle Herzpochen, das eine unglaubliche Enge in meiner Brust erzeugte. Die Illusion, in der ich jahrelang gelebt hatte, lag in Scherben vor meinen Füßen und ich erkannte, dass unsere Freundschaft auf eine Gabelung getroffen war. Ich kämpfte im Krieg, um ihn zu beenden, um eine friedliche Lösung für all das zu finden, während Miraa längst eine Lösung gefunden hatte, die alles beenden sollte. Hatte ich etwas Falsches getan? Hatte ich mich selbst belogen? Wie konnte ich dafür kämpfen, Shiana, Ea und Laan nicht zu opfern, während ich selber auf dem Schlachtfeld hunderte fremde Soldaten niederstreckte?
Ich hob meine von getrocknetem Blut beschmierten Hände und setzte zu einer Entschuldigung an, als mich der Schlag eines gegnerischen Soldaten am Kopf traf und ich zu Boden fiel, während Miraa diesen Soldaten beseitigte. Mein Gehör setzte aus und für einen Moment hörte ich alles nur wie ein stumpfes, weit entferntes Dröhnen. Ich richtete mich auf und entdeckte, dass Miraa wieder nah bei mir stand. Ganz langsam setzte mein Gehör wieder ein.
„Ich werde für unseren Traum kämpfen und diesen Krieg beenden!“, sprach er und schickte mit einer Handbewegung einige Mitglieder der Kinno-Bujin los. Ich zitterte und wandte meinen Blick in die Richtung, in die Miraa zeigte und beobachtete, wie die Spezialeinheit sich auf Shiana, Ea und Laan stürzte. Warum tat er das? Wollte er die drei nicht dafür missbrauchen, die Feinde zu besiegen? Warum kämpfte er nun gegen sie? Der Menschenhaufen bewegte sich so chaotisch, dass ich nicht genau erkannte, was geschah. Dennoch ging ich auf diese Masse zu und kämpfte mich an den Kinno-Bujin vorbei, um irgendwie zu Shiana vorzudringen. Immer wieder verpasste mir jemand Schläge; mein Körper war vor Schmerz schon ganz taub. Trotzdem floss eine unfassbare Energie durch meinen Körper, die in kleinen blauen Flammen aus meinen Fingerspitzen herausdringen wollte. Ich schob die Personen beiseite und gelangte endlich zu Shiana, der ein merkwürdiges Halsband umgelegt worden war. Sie lag auf dem Boden und wirkte plötzlich ganz verstört, also half ich ihr aufzustehen.
„Was ist das?“, fragte ich mich und versuchte das Halsband zu lösen; jedoch war es fest verschlossen.
„Ich weiß es nicht“, antwortete sie und legte ihre Hände auf meine. Ihre zarte Haut war warm; sie hatte keinen Schaden im Kampf genommen. Für eine Sekunde verlor ich mich in ihren strahlend blauen Augen. Dann bemerkte ich, dass Ea und Laan ebenfalls ein Halsband umgelegt worden war. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Während um uns der Kampf weiter wütete und sich die Kinno-Bujin nun um die angreifenden Soldatenhorden kümmerten, wirkte es trotzdem sehr still, dort wo Shiana und ich standen. Laan stand auf und half Ea hoch und erkundigte sich, wie es ihm ginge. Shiana jedoch fixierte meinen Blick.
„Ich weiß, was zu tun ist“, fing sie wieder an, mich von ihrem Plan zu überzeugen. „Es wird alles okay sein. Das alles wird ein Ende finden. Ich habe es gesehen – in der Zukunft.“
„Was, wenn dein toller Plan nicht funktioniert?“, hakte ich nach und packte ihre Schultern. Ich wollte nicht, dass ihr irgendetwas zustieß.
„Gaara“, erklärte sie, „ich habe Uzryuuk, Natoku und Servant schon den Weg in die Zukunft gezeigt. Ich … Ich konnte es einfach. Sie sind nicht mehr hier.“
„Von was redest du da!?“, fragte ich erschrocken und wurde dabei lauter. „Du meintest, du könntest den Krieg beenden, wenn du nicht mehr hier wärst. Ich dachte, du würdest von einem Fluchtplan sprechen …“
„Ich habe sie in die Zukunft geschickt und ich werde auch dorthin fliehen müssen“, sagte sie, als wäre es selbstverständlich, dass Zeitreisen so einfach gingen. „Es ist ein Fluchtplan.“
Mir war alles zu viel. Das Dröhnen des Kampfes fühlte sich zerreißend und chaotisch an. Es hinderte mich daran, dass ich auch nur einen klaren Gedanken fassen konnte. Alles drehte sich um die Frage, ob Shiana wirklich in die Zukunft reisen konnte. Ich konnte nichts sagen, also nahm ich ihre Hand und hielt sie fest, überzeugt davon, dass sie dadurch handlungsunfähig werden würde.
„Ich habe in der Zukunft gesehen, wie das alles ein Ende nimmt und auch, wie ich es aufhalten werde. Gaara, das ist die einzige Chance, das alles hier zu bewahren. Ich habe den Weg gefunden, die Welt zu retten, von der du mir erzählt hast.“
„Du wirst einfach so verschwinden, irgendwohin in die Zukunft? Werde ich auch da sein? Werden wir uns wiedersehen? Wird es dir gut gehen?“, sprudelte es so aus mir heraus und ich merkte nicht, dass mein Griff fester wurde und ich ihr näherkam. Mein Gesichtsausdruck musste entsetzlich sein, sonst hätte sie in diesem Augenblick nicht so schockiert geschaut. Ich sah die Spiegelung meiner Selbst in ihren weit aufgerissenen Augen und das Glitzern ihrer Tränen. Dann brach sie vor Schmerz zusammen. Zunächst dachte ich, dass mein Verhalten diese Schmerzen auslöste, aber ich erkannte schnell, dass nicht nur sie, sondern auch Ea und Laan plötzlich mit schmerzverzerrten Gesichtern auf dem Boden lagen. Hatte ich etwas getan, was ihnen diese Schmerzen bereitete?
„Es ist soweit“, sprach eine bebend laute Stimme, als ich mich hinkniete, um herauszufinden, was Shianas Schmerzen verursachte. „Die Zeit ist gekommen, diesem Krieg ein Ende zu bereiten.“
Es dauerte eine Weile, bis die Krieger die Stimme hörten und für den Moment, als sie sprach, den Kampf pausierten. Die Kinno-Bujin und die fremden Soldaten hörten auf, sich zu bekämpfen. Erschrocken von der unheimlichen Stimme, die über das ganze Gebiet ertönte, starrten sie zum Zentrum des Platzes, in dessen Mitte, umkreist von hunderten Personen, Miraa stand. Theatralisch hob er seine Hände, als würde er zu einem Gebet einstimmen.
„Wir haben endlich die Macht geschaffen, mit der wir Schmerz, Leid und Tod aus dieser Welt verbannen können! Oh, Brüder und Schwestern, ich kann euch in die neue Welt geleiten, in der es keinen Krieg mehr geben wird, in der es keinen Tod mehr geben wird!“, verkündete Miraa. „Kniet nieder vor dem Bezwinger der Götter, der euch von dem Leid dieses Lebens befreit.“
Als er das sagte, knieten sich alle Mitglieder der Kinno-Bujin auf den Boden und verschränkten ihre Arme. Ich sah bei genauerem Hinsehen, dass sie eine Art Mantra von sich gaben. Ich wehrte mich gegen diese merkwürdige Verzauberung, die versuchte sich mir zu bemächtigen. Unsicher darüber, was sie tun sollten, sah ich auch einige der fremden Soldaten sich zu Boden knien. Oder wusch das Mantra der Kinno-Bujin deren Gehirne? Deren Magie und Miraas Charisma schienen auszureichen, um alle Männer von ihren Überzeugungen reinzuwaschen. Ich hingegen konnte standhalten. Dafür fiel es mir schwer, meinen besten Freund wiederzuerkennen. Hatte er wirklich vor, die Macht der drei zu nutzen, um allem ein radikales Ende zu bereiten?
Shiana, Ea und Laan standen plötzlich auf, als wären sie in Trance.
„Seht, das sind unsere Götter!“, brüllte er, um noch lauter zu sein. Dann schwebte Laan in die Luft. Ea erschienen gläserne Flügel und auch er flog in die Lüfte. Shiana war die einzige, die auf dem Boden stehen blieb.
„Shiana!“, sprach ich und packte ihre Arme, doch sie löste sich schnell von meinem Griff und schritt in Richtung Miraa. Als sie sich um ihn versammelt hatten, sprach er weiter.
„Wer sich gegen den Frieden stellt, soll dafür bestraft werden!“, befahl er und beobachtete, wie einer der Soldaten über den Platz zu ihm rannte. Als er gerade durch die Menschenmenge auf einen leeren Teil des Platzes schritt, schnippte Miraa mit den Fingern und daraufhin streckte Ea seine Arme aus. Sein Gesichtsausdruck war leer, als er einen mächtigen Blitz aus seinem Schwert direkt auf den Soldaten abfeuerte. Der verkohlte, leblose Körper sackte zu Boden. Er hatte ein Exempel statuiert. Weitere Soldaten rannten auf Miraa zu und mit weiteren Handbewegungen ließ er Ea, Laan und Shiana seine Widersacher niederschlachten.
Meine Sicht verengte sich zu einem Tunnel, als ich Miraa direkt fixierte. Was auch immer er tat, ich spürte, dass die drei großen Schmerz verspürten und ich wusste, dass sie das nicht wollten. Ich wusste, dass Shiana niemanden bekämpfen wollte. Als sie vorher gegen die fremden Soldaten gekämpft hatte, hatte ich gesehen, dass sie diese nur verletzte, aber niemals getötet hatte. Sie hatte durch ihre Angriffe die gegnerische Armee gebremst, sodass die Kämpfe reduziert worden waren. Auch Ea und Laan hatten Rücksicht auf das Leben genommen und niemanden so verletzt, dass er deswegen sterben musste. Jetzt zu sehen, dass ohne ein Wimpernschlag eine Leiche nach der anderen auf dem Platz gestapelt wurde, war schrecklich. Konnte das ein Teil von Shianas Plan sein?
„Shiana! Hör auf!“, brüllte ich über den ganzen Platz, jedoch reagierte sie nicht auf mich. „Du willst das nicht!“ Ständig wiederholte ich, dass sie aufhören sollte, jedoch schien es so, als würde sie mich nicht hören. Lag es an diesen Halsbändern, die sie trugen? Wie konnte Miraa sie kontrollieren?
Ich hob meine Waffe auf, konzentrierte meine Energie und sprintete los. Nun loderten aus meiner ganzen Hand die blauen Flammen und ich fing an, Miraa zu attackieren. Dieser wich meinen Angriffen schnell und gekonnt aus. Er jedoch setzte nicht zum Angriff an.
„Gaara“, schnaufte er, „warum bist du so aufgebracht? Hast du nicht auch von Frieden geträumt?“
„Dein Frieden ist kein Frieden!“
„Doch, Gaara. Du weißt das genau. Du weißt im tiefen Inneren, dass es der einzige Weg ist, das Schlechte aus der Menschheit auszuradieren! Sie werden sonst immer wieder anfangen, wegen ihren belanglosen Wünschen zu morden und zu zerstören!“
„Damit rechtfertigst du das Morden?“, entgegnete ich und warf meine Waffe zu Boden. Ich versuchte es mit mehr Nahkampf, doch Miraa weichte immer noch gekonnt aus. Meine Verfassung – zu meiner Verteidigung – war miserabel. Ich atmete schwer, meine Gliedmaßen und meine etlichen Wunden schmerzten unheimlich und die ganze Situation vernebelte meine Wahrnehmung.
„Befreie Shiana! Sie darf nicht deine Marionette sein! Sie ist deine Freundin!“, forderte ich, doch meine Forderung wurde nicht beachtet.
„Sie ist kein Mensch, Gaara. Versteh doch, sie ist die Inkarnation einer Göttin!“, erklärte Miraa sich und ich erkannte den Wahn hinter seinen Worten. Es schien, als hätte ich meinen Freund komplett verloren. „Sieh nur, was sie können.“
Plötzlich kam mir Miraa ganz nah und hielt mich fest. Sein Gesicht war nur wenige Zentimeter von meinem entfernt und ich fixierte seine Augen. Aus dem Augenwinkel jedoch sah ich, wie sich Shiana, Ea und Laan plötzlich zu uns wendeten und anfingen zu leuchten.
„Was hast du vor!?“, brüllte ich Miraa an.
„Ich schenke uns Unsterblichkeit“, grinste er und die unendliche Leere in seinen Augen hielt mich für einen Moment im Bann. Plötzlich verspürte ich einen brennenden Schmerz und ertastete, dass er mir einen Dolch in den Bauch gerammt hatte. Warmes Blut floss aus meinem Körper und als ich versuchte, mich von ihm wegzustoßen, hielt er mich noch fester in den Armen. Zeitgleich richteten sich drei Energien auf Miraa und mich. Ea, Laan und Shiana schossen einen Energiestrahl auf uns. Das kraftvolle Licht umhüllte unsere Körper und ich wurde plötzlich ganz schwach. Keine Worte verließen meinen Mund und kein Gedanke konnte formuliert werden. Mir blieb nichts anderes übrig, als es über mich ergehen zu lassen. Doch sobald ich mich dieser Kraft hingab, ließ mich Miraa los und ich kam wieder richtig zu mir. Als das blendende Licht nachließ und ich auch wieder etwas sehen konnte, fühlte ich mich erstaunlicherweise kräftiger und mächtiger als zuvor. Was war passiert?
„Was … was hast du getan?“, verlangte ich zu wissen, als sich Shiana, Ea und Laan wieder dem Kampf widmeten.
„Ich habe uns unsterblich gemacht!“, lachte Miraa und deute auf meinen Bauch.
Verwundert stellte ich fest, dass die Wunde, die Miraa mir gerade zugefügt hatte, verschwunden war. Mehrmals tastete ich die Stelle ab und bemerkte, dass es mir gut ging. Getrocknetes Blut war um das Loch in meiner Kleidung zu sehen; ein Beweis, dass ich mir das Ganze nicht eingebildet hatte.
„Deine und meine Seele sind miteinander verknüpft, Gaara. Das hätte ich viel früher erkennen sollen! Unsere Freundschaft ist etwas Besonderes“, erklärte er mir und ich verstand nicht, worauf er hinauswollte. Nun aber, als er mir mit seinen Gesten zeigen wollte, dass er mir freundlich gesinnt war, erkannte ich, dass er an seinen Armgelenken jeweils einen Armreif trug, der den Halsbändern von Shiana, Ea und Laan glich. Kontrollierte er sie damit?
Ich drehte mich um mich selbst und erkannte, dass alle Mitglieder der Kinno-Bujin, die immer noch auf dem Boden knieten, solche Armreife trugen. Das musste der Schlüssel sein!
„Von was auch immer du schwafelst, Miraa, ich werde dem Ganzen ein Ende setzen. Niemals werde ich es zulassen, dass du die Seelen dieser drei opferst, um diese Welt zu erschaffen, von der du sprichst.“
Ich begab mich in Kampfstellung. Miraa stand lachend vor mir und lud mich winkend ein, wieder anzugreifen. Überheblich blickte er auf mich herab, als würde er sagen ‚Du wirst mit mir diese Welt erschaffen, ob du willst oder nicht‘.
Teil V
„Ich wollte in einer friedlichen Welt leben. Warum muss man für Frieden immer kämpfen, um andere davon zu überzeugen? Warum wollen Menschen nicht auch Frieden?“ – Gaara
Mir wurde nun alles klar. Shiana hatte recht. Sie musste fliehen. Die Macht, welche die drei besaßen, durfte nicht von Miraa oder irgendwem missbraucht werden. Miraas radikale Einstellung zur Erneuerung der Welt war wie ein giftiger Samen, der nicht austreiben durfte. Mir blieb nichts anderes übrig, als dem Ganzen ein Ende zu bereiten.
Also nahm ich all meine Energie zusammen und wusste, dass ich meine spezielle Technik des Genkioken verwenden musste, um schnell zu reagieren. Ich ließ es zu, die Kontrolle über den Energiefluss zu verlieren und ließ alle Kraft frei, die ich aufbringen konnte. Blaue Flammen züngelten erst über meine Finger, dann über meine Hand und umhüllten schließlich meine Arme. Ich spürte die warme Macht, die ich freiließ und sofort auf alle Mitglieder der Kinno-Bujin richtete. Der Energiestrahl fetzte einige Krieger um und ich erkannte, dass Miraas Gesichtsausdruck für eine kurze Sekunde entgleiste. Das war meine Chance. Ich sprintete auf Miraa los und griff nach seinen Händen. Als ich die Armreife spürte, drückte ich mit aller Macht zu und versuchte, diese zu zerstören. Das Metall verbog und Miraa fletschte mit den Zähnen.
„Lass das!“, brüllte er mich an. „Du zerstörst alles!“
Mit meinen Knien trat ich zu und versuchte, ihn bestmöglich abzulenken und ich realisierte, dass es klappte! Shiana, Ea und Laan schienen ihr Bewusstsein wiederzuerlangen.
„Zerstört die Halsbänder!“, rief ich so laut ich konnte und die erste Person, die reagierte, war Ea. Er schnitt mit seinem Schwert Laans Halsband entzwei. Danach stürzten sich beide auf Shiana und befreiten sie ebenfalls und anschließend Ea von deren Halsbändern.
„Unser Traum!“, brüllte mich Miraa an und als Antwort erhielt er von mir einen Schlag ins Gesicht. Er taumelte zurück und tastete die Stelle im Gesicht ab, die ich getroffen hatte. Blut trat aus seiner Nase. Sein Ausdruck veränderte sich und es wirkte nicht mehr so, als würde er mich höflich um etwas bitten.
„Es ist soweit, du musst jetzt fliehen!“, forderte ich Shiana auf, als ich mich kurz zu ihr wandte. Es war ein fataler Fehler, weil Miraa mir auf den Rücken sprang und mich würgte. Röchelnd taumelte ich einige Schritte umher und versuchte, ihn von mir loszubekommen. Als nächstes nahm ich nur wahr, dass Laan vor mir stand und seine Faust in meinen Bauch rammte. Seine Hand war von einer leuchtenden Box umschlossen; als er mich jedoch traf, spürte ich keinen Schmerz. Ganz im Gegenteil fühlte ich mich plötzlich leicht und hob vom Boden ab. Miraas Griff löste sich allmählich und ich konnte mich befreien. Dann brauchte es nur den Bruchteil einer Sekunde, dass ich wieder auf dem Boden ankam und die Schwerelosigkeit sich löste. Ich war beeindruckt von dem, was Laan gerade gemacht hatte. Jedoch hatte ich keine Zeit zum Durchatmen, da Miraa wieder auf den Beinen stand und mich angriff. Nun konzentrierte er auch seine Energie und eine dunkle Aura umgab ihn. Wir kämpften im Nahkampf und tauschten dabei Tritte und Schläge aus.
„Shiana, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, zu fliehen!“, brüllte ich und sah im Augenwinkel, dass sich einige der Kinno-Bujin wieder auf sie stürzten. Mittlerweile wusste ich nicht mehr, wer gegen wen kämpfte. Es spielte keine Rolle mehr, dass unser Königreich angegriffen wurde, sondern nur noch, dass ich verhindern konnte, dass Shiana als Waffe missbraucht wurde.
„Jetzt ist nicht der Zeitpunkt!“, antwortete sie, als sie mit ihren Lichtpfeilen versuchte, ihre Angreifer auf Abstand zu halten.
„Was soll das denn heißen!?“, brüllte ich.
Laan, der neben mir ebenfalls gegen Miraa kämpfte, sagte ruhig: „Vertrau ihr, sie weiß, wann es passt.“
Mich wunderte es, dass Laan so ruhig bleiben konnte.
„Ja, vertrau ihr!“, rief auch Ea, der einige der Kinno-Bujin mit seinem Schwert zurückhielt.
„Ihr werdet es nicht schaffen, mich aufzuhalten“, sprach Miraa im Wahn. Sein Blick war leer und ich spürte, dass er sich in einer unkontrollierbaren Rage befand. „Bald, bald erschaffe ich den ultimativen Frieden!“
„Miraa, du musst aufhören“, versuchte ich zum letzten Mal, ihn zu überreden, als ich ihm einen heftigen Tritt in die Magengegend verpasste. Er röchelte kurz nach Luft und hielt einen Moment inne.
„Du bist mein bester Freund, Gaara“, sagte er und wischte sich das trocknende Blut um seine Nase weg. „Ich wünsche mir nichts mehr, als dass du mit mir in einer friedlichen Welt leben kannst.“
„Schau dich doch um! Dein Fundament soll dieser Haufen an Leichen sein!?“, brüllte ich erzürnt. „Das ist nicht der Weg, den ich für uns gesehen habe, Miraa!“
„Das … Das ist es!“, erkannte Miraa plötzlich, hielt sich sein Gesicht und fing an, zu lachen. „Das ist der einzige Weg, Frieden zu erlangen!“
„Wovon sprichst du!?“, wunderte ich mich. Laan und Shiana hielten inne. Ea schlug mit einem finalen Schwerthieb einige der Soldaten um sich herum bewusstlos. Es herrschte Stille. Keiner kämpfte mehr.
Die merkwürdige Aura um Miraa wurde intensiver. Ich spürte eine knisternde Aufladung in der Luft. Um Miraa herum schwebten einige kleine Steine empor und die Energie in ihm wurde stärker. Seine Augen verdrehten sich, sodass man nur noch das Weiße sah. Laan und Ea begaben sich in Kampfstellung und ich wusste nicht, was mich erwarten würde.
„JETZT!“, rief Shiana, als die längsten Sekunden meines Lebens begannen. In diesem Augenblick spielten sich etliche Geschehnisse zeitgleich ab. Shiana fing, wie einige Momente vorher, an zu leuchten. Sie streckte ihre Arme aus und erschuf mehrere leuchtende Kugeln, die an fünf unterschiedlichen Orten in Bodennähe oder in der Luft schwebten. Sie strahlten ein kühles, ruhiges Licht aus und ich konnte nicht erkennen, was sie beherbergten.
„Ea, Laan, wie besprochen!“, befahl sie und lief auf eine der Lichtkugeln zu. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. „Gaara, ihr müsst ins Licht gehen!“
Bevor ich jedoch verarbeiten konnte, was sie von mir wollte, schoss Miraa mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf mich zu und packte mich.
„Wir müssen sterben, Gaara! Die nächste Welt ist die friedliche Welt! In der wir unsterblich sind!“, sprach er sehr schnell, während sein starker Griff meine Kehle zudrückte. Ich bekam keine Luft, griff nach seinen Armen und versuchte wieder, mich davon zu lösen. Shiana zögerte für einen Moment, ins Licht zu gehen und wandte sich mir zu. Jedoch signalisierten Ea und Laan, dass sie nicht intervenieren sollte. Laan versuchte, Miraa zu packen und von mir loszureißen. Ea zückte sein Schwert, welches die Form eines Hammers annahm und schlug auf Miraa ein, der sich jedoch kein Stück bewegte. Die Hitze und Energie, die sein Körper ausstieß, rissen Fetzen aus dem Boden, die von uns weggeschleudert wurden. Explosiv drängte die Energie in Wellen durch die Umgebung und verletzte mich an Gesicht, Armen und Körper. Ich konzentrierte meine Energie und versuchte, sie auf Miraa zu lenken. Als sich Miraas und meine Energie zwischen uns vermengten, explodierte sie in einer Druckwelle, welche die Gebäude der Umgebung in Stücke riss. In der Sekunde, als mein letzter Lebenshauch meinen Körper verließ, erkannte ich, dass Laan Shiana in eine der Lichtkugeln stieß und gleich darauf im Nichts verschwand. Ea, der noch versuchte, Miraa von mir loszureißen, schleuderte es etliche Meter von uns weg. Trotz des blendenden Lichts erkannte ich Miraas leeren Gesichtsausdruck. Dann verschwand alles in einem farblosen Weiß.
Das nächste, an das ich mich erinnern konnte, war, dass ich aufwachte – in einem fremden Körper. Fortan suchte ich fast viertausend Jahre lang nach Shiana, Ea, Laan und Miraa.
Kapitel 60 – Die Konfrontation
Die untergehende Sonne färbte die Dünen der Wüste in ein bedrohliches Rot. Nachdem der Sturm sich gelegt hatte, konnte man die Muster erkennen, die der Wind über die Berge von Sand gemalt hatte. Immer wieder wirbelten weitere Windböen Sand auf und zogen diese Schleier einige Meter mit sich, bevor der Wind die feinen Körner wieder fallen ließ. Der Wind kam mit einer Kühle, nach der sich einige der Gruppe nach dem langen, anstrengenden Tag gesehnt hatten.
Eimi fand es überraschend schwierig, durch den Sand zu wandern. Seine Schuhe versanken viel zu tief und er merkte, wie einige der Sandkörner zwischen seinem Fuß und der Sohle nervig knirschten; ein wirklich unangenehmes Gefühl, mit dem er sich in dieser Situation abfinden musste. Die Gruppe bestand aus Pecos, seinen engen Sondereinheitsmitgliedern Khamal, Tresna, der Mechaniker und dem alten Hol – Personen, die Eimi schon in Prûo kennengelernt hatte – sowie weiteren Mitgliedern der Schutztruppe. Kurz hinter ihnen liefen die zwei Mitglieder der Vastus Antishal: Shin, der für die Kommunikation zuständig war und Hakashi, der rothaarige Mann, von dem Eimi noch nicht so viel wusste. Das Schlusslicht der Gruppe bildeten Ea, Tsuru und Eimi selbst, der nachdenklich zurück zur Stadt blickte, deren Stadtmauern von außen noch viel mächtiger zu sein schien als von innerhalb der Stadt.
Der Pfad führte sie in nordöstliche Richtung. Khamal führte die Gruppe an die Ausläufer des Gebirges. Er meinte, dort wäre die Umgebung durch einen festen Untergrund und geheime Höhlengänge sehr praktisch, um Lager aufzuschlagen und Angriffe auf die Stadt vorzubereiten. Laut den Informationen, die Khamal mit Pecos teilte, sollte sich dort Vaidyam und seine Gruppe aufhalten und auf weitere Anweisungen von Vaidyams Anführer, dem geheimen Kopf hinter all den Geschehnissen der letzten Zeit, warten. Die Bilder aller Ereignisse drehten sich in Eimis Kopf wie ein Karussell; in der Mitte davon die Erinnerung der entführten Frau. Vor einiger Zeit hatte er ebenfalls davon geträumt, wie er der Frau aus dem Zug begegnet war. In seinem Traum schien er endlos durch die Abteile des Zuges zu rennen, immer wieder der Frau hinterher, die ihm die ganze Zeit über nur ihren Rücken zeigte und sich niemals umdrehte. Wiederholt kämpfte er sich mit aller Kraft nach vorn; es war, als würde eine geheimnisvolle Kraft ihn zurückhalten, voranzukommen. Am Ende des Traumes stolperte er im Bereich zwischen zwei Abteilen über die Kupplung der Wagen und landete nach einem langen, dunklen Fall dadurch im Labor. Dort war es dunkel und ein maschinelles dumpfes Wummern dröhnte durch seinen Kopf mit tiefem Bass. Gefesselt an eines der Betten musste er Klone gebären – dunkle Klumpen undefinierbaren Fleisches – einen nach dem anderen, bis er seiner Anstrengung erlag, wie es all die Frauen neben ihm taten. Als er in jener Nacht schweißgebadet aufwachte, konnte er mit niemanden darüber reden. Die Sorgen, die seine Freunde hatten, waren viel schwerer als dieser wiederkehrende Albtraum.
Er hatte eine Rechnung mit Vaidyam offen, genauso wie es Tsuru und Ea taten. Er musste es einfach verhindern, dass Vaidyam weiterhin grässliche Experimente an Menschen durchführte, um Wesen herzustellen, die nur als Waffen für einen Krieg verwendet wurden. Er war sich auch sicher, dass Tsuru das Gleiche empfand. Wie es sein musste, neben Ea zu laufen? Er wusste es nicht. Sie war sein Klon, obwohl sie nicht im Geringsten aussah wie er. Wie auch immer das funktionierte, Eimi verstand es nicht. Genauso wenig wie er verstand, was Ea nun für sie war. Machte es ihn zu ihrem Vater? Als er darüber nachdachte, wie man die Familienstrukturen eines Klons und dessen Ursprung aufzeichnete (und das Wort Ursprung gefiel ihm als Definition Eas), gelangte die Gruppe so langsam auf festeren Untergrund. Das fast hypnotische Knirschen der Schritte auf dem sandigen Gesteinsboden war nicht ganz im Takt und hatte einen ganz anderen Klang, als nur auf Sand zu laufen. Allmählich ging es bergauf und die Gruppe schien aus irgendeinem Grund langsamer voranzukommen. Eimi konnte sich das nicht erklären, deswegen beobachtete er die anderen etwas. Shin hielt mehrmals seinen Apparat an sein Ohr und checkte wohl, was die anderen Mitglieder der Vastus Antishal zu berichten hatten. Er sprach mehrmals mit Pecos darüber; Eimi konnte jedoch kein Wort verstehen. Pecos Gesichtsausdruck schien jedoch nicht gerade erfreut über das zu sein, was Shin berichtete.
Dann, auf einem Plateau, nach einer Weile der Wanderung, machte die Gruppe eine kurze Rast. Einige der Schutztruppler tranken etwas aus Wasserschläuchen, die sie an ihren Taschen befestigt hatten und boten Ea, Tsuru und Eimi ebenfalls etwas an. Eimi war in seinen Gedanken mittlerweile bei seinen Freunden und die Sorgen und Vorwürfe, sie im Stich zu lassen, wurden mal wieder etwas lauter. Es war doch die richtige Entscheidung, zu helfen den Krieg zu beenden, oder? Die Unsicherheit über seine eigenen Ziele verwirrten ihn. Alayna und Takeru wurden sicherlich bald gefunden, nun, da mehrere Mitglieder der Vastus Antishal und der Schutztruppe die Suche aufgenommen hatten. Außerdem waren da ja noch ihre Mutter, Oto und die anderen, die Ausschau hielten. Trotzdem beschlich ihn ein ganz merkwürdiges Gefühl.
Eimi drehte sich in Richtung der Stadt, um mit dem Ausblick einen klaren Gedanken zu fassen und einmal durchzuatmen. Er musste sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wenn irgendwelche Gedanken ihn nun ablenkten, schadete das sicherlich der Mission. Außerdem war es wichtig, Vaidyam und seine Gruppe auszuschalten, dass niemanden mehr – nicht einmal Alayna und Tak – etwas durch die Gefahr, die von diesem Verrückten ausging, zustoßen konnte. Er musste ein für alle Mal gefasst werden.
Von dieser erhöhten Position konnte er perfekt sehen, wie die Sonne sich dem Horizont näherte, der immer noch aus Sand zu bestehen schien. Diese Wüste musste gigantisch groß sein. Außerdem konnte er auch perfekt auf die Stadt sehen. Er erkannte den großen Platz in der Mitte und die Oasen, die sich innerhalb der Stadtmauern befanden. Jedoch wunderte ihn etwas, das sich hinter der Stadt im Westen zu befinden schien.
„Erkennst du, was das ist?“, fragte er Tsuru, die gerade noch dabei war, etwas Wasser zu trinken. Eimi erkannte etwas, konnte es jedoch nicht richtig sehen, da ihn die Sonne blendete. „Siehst du diese Punkte?“
Tsuru wandte sich Eimi zu und suchte auch angestrengt den Bereich hinter der Stadt nach Hinweisen ab.
„Das ist so klein, ich weiß nicht“, verneinte sie, putzte ihre Brille mit ihrem Oberteil und setzte diese wieder auf, als würde es daran liegen, dass sie nichts hatte erkennen können.
„Der Rest der Wüste sieht nicht so aus; sind das Felsen?“, hakte Eimi nach, aber Tsuru zuckte unwissend mit den Schultern.
Dann mischte sich theatralisch Ea ein, der die Unterhaltung mitbekommen hatte.
„Lasst mich mal schauen“, kündigte er an und hielt sich die Hand über die Augen, um nicht von der Sonne geblendet zu werden. Er beugte sich nach links und nach rechts, ging in die Knie und versuchte mehrere Posen aus, um einen besseren Blick auf den Bereich hinter der Stadt zu erhaschen.
„Das ist ein Lager!“, stellte Ea überrascht fest und versuchte mit dem Finger auf gewisse Punkte zu deuten, die Tsuru und Eimi genauer anschauen sollten.
„Seht ihr, dort steht ein ganz großes Zelt; man erkennt die Spitze davon. Die hellen Punkte sind Fackeln. Man sieht nicht alle, aber das müssen unglaublich viele Leute sein, die dort campieren“, erklärte er weiter.
„Ein Lager? Mitten in der Wüste?“, wunderte sich Eimi.
„Was, wenn das noch mehr Krieger der Organisation sind, die sich schon auf den Angriff auf die Stadt vorbereiten?“, befürchtete Tsuru.
Reflexartig bewegte Eimi seine Hände in den Bereich, an dem früher das Schwert hing und griff dabei ins Leere. Er tastete dabei konzentriert in die Ferne schauend nach seiner Waffe und stellte enttäuscht fest, dass er sie nicht mehr hatte.
„Sie sind der Stadt schon so nahe“, meinte er mit Sorge in der Stimme. „Warum ist das den Leuten in Jiro-Khale noch nicht aufgefallen?“
„Vielleicht sehen sie das Lager von der Stadt aus nicht? Schau, das zwischen dem Lager und der Stadt scheint eine große Sanddüne zu sein. Außerdem würde man niemals denken, dass jemand tatsächlich so dumm wäre, in der nackten Wüste ein Lager aufzubauen“, vermutete Tsuru.
„Wir müssen das Pecos melden. Vielleicht müssen wir zurück zur Stadt“, erkannte Eimi und ging mit seinen Begleitern zum Leiter der Schutztruppe.
„Pecos, Pecos!“, forderte Eimi seine Aufmerksamkeit und unterbrach ein Gespräch zwischen ihm und Khamal. „Wir haben vor der Stadt ein merkwürdiges Lager entdeckt und müssen zurück, um die anderen zu warnen. Wir denken, dass das der Feind ist, der die Stadt bald angreifen will.“
„Wissen wir schon“, antwortete Pecos kurz und wandte sich wieder zu Khamal. Eimi wunderte sich über die Reaktion und verlangte wieder nach seiner Aufmerksamkeit.
„Aber hast du nicht gehört? Wir sollten zurück, um die anderen zu warnen“, forderte Eimi nun etwas energischer.
Er sah, dass Khamal seine Augen verdrehte, als Pecos sich zu ihm wendete.
„Hör zu, Shin hat mir alles schon erklärt. Unsere Gruppen sind dabei, sich darum zu kümmern. Der Angriff, den sie auf die Stadt planen, wird unvermeidbar sein. Wir sind jedoch darauf vorbereitet, mach dir also keine Sorgen, ja? Wir müssen uns auf diese Mission konzentrieren.“
„Aber …“, setzte Eimi an, wurde aber von Pecos unterbrochen. Er wandte sich nun an alle; Ea und Tsuru waren auch nicht mehr in der Lage, etwas zu sagen. Dann hielt Pecos eine kurze Ansprache.
„Hört zu. Wir sind Vaidyams Standort sehr nahe. Unsere Mission startet gleich. Ich möchte, dass ihr das anwendet, was ihr im Training von uns erfahren habt.“ Einige der Schutztruppler nickten sich bestätigend zu. „Dieser Krieg wird an mehreren Fronten gekämpft. Wir, unsere Kameraden, unsere Teammitglieder, unsere Brüder und Schwestern und unsere Verbündeten sind alle bereit, das zu beschützen, wofür unsere Welt steht und was sie am meisten braucht: Frieden. Diesen Frieden werden wir mit allem verteidigen, was wir haben. Und jetzt macht euch bereit; es geht auf unser Zeichen los.“ Dann wandte sich Pecos an Tsuru, Ea und Eimi. „Wir haben euch nicht in den Ablauf der Mission eingeweiht. Deswegen möchte ich, dass ihr drei bitte immer in Shins Nähe bleibt, ja?“
„Aber Pecos“, wehrte sich Tsuru, fand jedoch keine passenden Argumente, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
Es war Ea, der sich mehr gegen diese Entscheidung wehrte. „Das werde ich nicht!“, kündigte er lautstark an.
„Ich sag es, wie es ist“, mischte sich Shin mit ein, der kein Problem damit zu haben schien, sich um Tsuru, Eimi und Ea zu kümmern. „Wir stehen Pecos und den anderen nur im Weg; das ist das Problem. Wir müssen bereit sein, für alle Eventualitäten, sogar für einen Rückzug ohne Pecos.“
Pecos wandte sich ab, er schenkte Tsuru noch einen letzten bestimmten strengen Blick, jedoch hielt dieser Austausch von Blicken nur sehr kurz an. Dann sah sie ihm mit einem traurigen Blick hinterher.
„Ich werde nicht ohne Pecos gehen“, beharrte sie und biss sich dabei auf die Lippe. Eimi bemerkte, dass ihre Hände zitterten. „Ich kann das nicht zulassen. Hör zu, Shin, ich bin sehr wohl in der Lage zu kämpfen, auch wenn Kûosa nicht da ist. Ich kann mich verteidigen. Ich werde keine Bürde sein.“
Shin kratzte sich unsicher an der Schläfe. Dann gab ein merkwürdiges Rauschen seines Apparates ein Signal und er wandte sich ab, um daraus weiteren Nachrichten seiner Kollegen zu hören.
Eimi wandte sich Tsuru zu.
„Ich werde das nicht zulassen, dass wir nur herumstehen“, ermutigte er sie in einer leisen Stimme, sodass die Leute um sie herum sie nicht hören konnten. „Wir müssen Vaidyam aufhalten und so wie wir ihn kennengelernt haben, brauchen wir jede Hand dafür.“
„Eimi, ich bringe dich in Gefahr, das möchte ich nicht“, gestand sie und wirkte auf einmal sehr unsicher.
„Mach dir keine Sorgen, ich habe zwar keine Waffe mehr, aber ich kann trotzdem etwas bewirken“, sagte Eimi und hoffte, dass man die Zweifel in seiner Stimme nicht hörte, die er aber hatte.
„Du hättest halt das Schwert nicht verlieren dürfen“, ärgerte sich Ea, der theatralisch auf den Boden stampfte. „Schau doch einmal, wie leicht das alles gewesen wäre, wenn wir es nun hätten!“
„Es tut mir leid“, entschuldigte sich Eimi. „Ich habe dir gesagt, dass ich es wiederfinde.“
„Na, da kann man nichts machen“, seufzte Ea und popelte in der Nase.
Manchmal wunderte sich Eimi schon ziemlich darüber, wie merkwürdig sich Ea verhielt. War er jetzt wütend, oder nicht? Eimi konnte das einfach nicht einschätzen.
„Wäre aber schon praktisch, wenn du eine Waffe hättest“, grübelte Ea und sah sich neugierig um. Dann signalisierte ein fieses Grinsen, das sich vom einen zum anderen Ohr erstreckte, dass er etwas entdeckt haben musste. Er schlich sich zu einem Schutztruppler von hinten an und deutete an, dass er demjenigen gleich sein Schwert stehlen würde.
„Halt, halt, was machst du da!?“, wehrte sich der Schutztruppler, als er Ea – so auffällig wie er war – dabei erwischte, ihm etwas stehlen zu wollen. Ea brach dabei in Gelächter aus, eine noch viel merkwürdigere Reaktion.
Eimi kam mit dieser Situation nicht klar und ließ sich für einen Moment auf einen großen Felsen nieder. Als er sich setzte, schweifte sein Blick zurück in die Richtung der Stadt, die bald einen gefährlichen Angriff zu erwarten hatte. Was machte er sich nur vor? Er fuhr sich durch die Haare und akzeptierte, dass er ohne Waffe und ohne besondere Fähigkeiten nicht in der Lage war, überhaupt wen zu beschützen. Warum nur bildete er sich ein, das tun zu müssen? Vielleicht weil, nachdem dies alles enden würde, er immer noch in der Lage sein musste, das, was ihm wichtig war, beschützen zu können?
Er konnte sich einfach nicht vorstellen, nach Hause zu seiner Familie zurückzukehren. Zwar vermisste er seine Freunde und das Waisenhaus, jedoch fiel ihm da eine Person ein, für die es noch wichtiger war, stark zu sein.
Es war Alayna.
Wenn er seine Augen für einen kurzen Moment schloss, dann war es immer ihr Anblick, den er sah. Obwohl alles so verzweifelt zu sein schien und obwohl er sie gerade irgendwie im Stich ließ, musste er sich beweisen, dass er in der Lage war, stark zu sein. Die Konfrontation mit Vaidyam sollte sein Test sein. Wenn er diesen Test bestand, dann konnte er wieder Alayna suchen gehen, sie finden und dann wäre alles in Ordnung. Er musste ihr nichts beweisen, jedoch sich selbst. Er musste sich selbst beweisen, dass er jemand sein konnte, der in der Lage war, dieser Gefahr zu trotzen; ein Symbol aller Gefahren, die auf dieser Welt lauerten. Dann war er es würdig, es Alayna zu sagen. Nur was zu sagen? Was schlummerte in seiner Brust, das er ihr sagen wollte? Was musste gesagt werden, damit er diese merkwürdigen, undefinierbaren, schlummernden Sorgen loswerden würde?
„Eimi“, unterbrach ihn Tsuru in seinen Gedanken. „Danke, dass du da bist. Danke. Irgendwie weiß ich ja, dass Pecos mich nur beschützen will. Aber dass er mir so den Rücken kehrt, das tut irgendwie weh. Es ist schön zu wissen, dass ein Freund wie du an meiner Seite ist.“
Tsuru musste wohl ihren eigenen Gedankenmonolog gehabt haben. Es war auch für Eimi schön, dass eine Freundin wie Tsuru an seiner Seite war.
„Und ich weiß auch, dass er mir niemals wehtun wollen würde, niemals. Aber …“
Sie hielt für einen Moment inne und sah zu dem Haufen Schutztruppler, in deren Mitte Pecos stand und weitere Anweisungen gab.
„Weißt du, es tut nur so unfassbar weh, nicht in seiner Nähe zu sein. Ich würde alles dafür opfern, bei ihm zu sein. Ich fühle mich bei ihm so ..“
„… so sicher? So wohl? Einfach nur glücklich?“, vervollständigte Eimi ihren Satz. Ihr überraschter Blick bestätigte seine Annahme.
„Woher weißt du, was ich meine?“, fragte Tsuru mit einem traurigen Lächeln auf dem Gesicht. Hatte sie so etwas nicht schon einmal vor ihm erwähnt?
‚Weil ich mich selbst so fühle‘, sprach Eimi in Gedanken, traute sich aber nicht, diese Worte laut auszusprechen, zumindest noch nicht. „Man sieht es dir an“, sagte er stattdessen.
„Aber weißt du was“, sprach sie mit einem kleinen Lacher und starrte auf ihre Hände. „Ich glaube, ihm tut es weh zu wissen, zu was diese Hände im Stande sind. Er kämpft diesen Kampf für mich, für meine Erlösung von … von dem hier!“
Sie bewegte ihre Hände aufgeregt auf und ab, um zu verstehen zu geben, dass ihre Hände für ihre Fähigkeit standen, etwas miteinander zu fusionieren.
Eimi wusste nicht genau, was er darauf antworten sollte. Dann sprang Tsuru auf und sagte erfreut: „Das ist es! Warum habe ich nicht schon längst daran gedacht?! Du bekommst eine Waffe, Eimi“, grinste sie.
In diesem Moment kam Ea von den etlichen Versuchen zurück, den Schutztrupplern für Eimi ihre Waffen abzunehmen. Neugierig gesellte er sich zu Eimi und sah zu, was Tsuru machte.
„Weißt du, daran habe ich ja gar nicht gedacht“, lachte sie. Dann bückte sie sich, um den Boden nach etwas abzusuchen. Sie sammelte etwas ein, das Eimi im ersten Augenblick gar nicht erkannte. Dann kam sie mit einigen Steinbrocken, Zweigen und einem Ast zurück.
„Weißt du, es wird nicht ganz so stabil sein, wie eine Waffe aus Metall, aber für den Anfang“, fing sie an zu erklären. Dann strahlte ein hell leuchtendes Licht aus ihren Händen und die Einzelteile fusionierten. Erst als die Lichtstrahlen schwächer wurden und dann ganz verschwanden, hielt sie ein Schwert in der Hand, das so ähnlich aussah wie Eimis. Der Griff war aus festem Holz und die Klinge aus Gestein. Eimi nahm es ihr ab, bedankte sich und sah es sich genau an. Obwohl es aus Stein war, ließ sich trotzdem gut in den Händen halten und es schien scharf zu sein. Jedoch bemerkte er, was sie damit meinte, dass es nicht so ganz stabil war. Zwar war die Steinklinge fest, jedoch schien sie nicht so flexibel und widerstandsfähig zu sein, wie ein echtes Schwert.
„Es tut mir leid, dass ich nicht schon längst daran gedacht habe. Aber wenn du etwas beschützen willst, brauchst du das dafür“, sprach sie zu Ende und freute sich.
Ea, der dem ganzen fasziniert zusah, freute sich auch.
„Aber da kann ich doch auch helfen“, lachte er, popelte noch einmal in der Nase und schnippte den kleinen grünen Ball an Popel von seiner Fingerspitze.
Eimi und Tsuru sahen angewidert zu ihm und wussten nicht, was sie zu erwarten hatten. Dann griff Ea nach dem Schwert und nahm es Eimi ab. Er begutachtete es von allen Seiten, roch daran und leckte mit seiner Zunge einmal über den Griff; eine wirklich widerliche Geste. Eimi und Tsuru verzogen vor Ekel ihre Augenbrauen. Dann warf Ea es erst einmal, dann ein zweites und ein drittes Mal in die Luft, wie als würde er das Gewicht des Schwertes testen. Eimi konnte sich keinen Reim darauf machen, was das zu bedeuten hatte.
Dann, in einem Augenblick, in dem Eimi nicht wirklich aufpasste, erstrahlte ein weiteres Licht und zwischen Eas Fingern verwandelte sich das Schwert aus Stein in ein Schwert aus Metall.
„Tja, das ist jetzt besser“, sagte er stolz, ging in die Knie und hielt das Schwert hoch, als wäre es ein Neugeborenes und er der Vater. „Bitteschön!“
Er übergab es Eimi wie ein heiliges Artefakt. Das Gewicht und die Breite des Schwertes waren ganz anders, als er es bisher gewohnt war. Natürlich war es schwerer; das vorherige Schwert hatte keine Klinge besessen. Er hielt es in zwei Händen und schwang es zum Test einmal hin und her. Dann stach er es in den Boden, damit es stand. Nachdem Eimi sich bedankt hatte, betrachtete er die zwei Personen, die vor ihm standen und erkannte ihre Verbindung. Sie beide beherrschten das Material, zwar auf eine andere Art und Weise, aber sie taten es. Er war dankbar dafür. Jetzt konnte er sich beweisen.
Kurz darauf erfuhr Eimi, warum die Gruppe so lange auf ihren Einsatz wartete. Khamals Treffen mit Vaidyam sollte stattfinden, wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwand. Die Mitglieder der Schutztruppe und der Vastus Antishal verteilten sich in der Umgebung, suchten sich Verstecke und hielten sich für einen Hinterhalt bereit.
Zu Eimis Überraschung ließ sich Pecos von seinen Teammitgliedern fesseln. Ihm wurden Handschellen an Füßen und Händen angelegt. Dann wälzte er sich einige Mal im Dreck hin und her, um so auszusehen, als wäre es ein Kampf gewesen, sich verschleppen zu lassen. Seine Revolver ließ er vorher in seiner Kleidung verstecken, sodass es so aussah, als hätte er keine Waffen bei sich.
Dann passierte etwas, was Tsuru kurz den Atem zu rauben schien. Pecos stellte sich vor Khamal und sah ihm tief in die Augen.
„Tu es“, sprach Pecos.
„Ist das wirklich nötig?“, wunderte sich Khamal und stand still und streng da. Die Aura, die diesen Mann umgab, war von einer merkwürdigen Angespanntheit erfüllt.
„Ja, tu es“, befahl Pecos in einem strengeren Ton und grinste dabei.
Dann holte Khamal blitzschnell aus und verpasste ihm einen Schlag auf sein linkes Auge. Der Ton, der durch den Aufprall der Faust auf dem Auge entstand, hörte sich grässlich an. Pecos schwankte und fiel zu Boden, kaum in der Lage, sich von selbst aufzurichten.
„Was sollte das!?“, brüllte Tsuru und stürmte zu Pecos. Sie war mehr über ihn als über Khamal verärgert. Dann zerrte sie ihn wieder auf die Beine und sah zu, wie er sie angrinste. Aus seiner Nase lief etwas Blut und das Auge rötete sich langsam. Khamal dehnte seine Finger, sein leichtes Grinsen verschwand schnell wieder.
„Alles für die Glaubwürdigkeit“, erklärte Pecos. „Wer würde denn davon ausgehen, dass ich mich nicht bis zuletzt wehren würde?“
„Was habt ihr jetzt vor?“, wollte Tsuru unbedingt wissen. Ihre Körperhaltung verriet, dass sie danach suchte, wie sie Pecos helfen konnte. Er verweigerte jedoch jede Hilfe von ihr und versuchte von selbst wieder auf die Beine zu kommen, was sich als schwierig herausstellte.
„Nun ja“, fing Pecos an zu erklären. Seine Gesten waren davon geprägt, dass er seine Hände nicht sonderlich frei bewegen konnte. „Khamal liefert mich aus, als Zeichen seiner Loyalität. Dann, wenn die Konzentration Vaidyams davon abgelenkt ist, mit mir Experimente durchführen zu wollen, schlagen wir zu. Das bedeutet, dass wir den Moment der Überraschung ausnutzen.“
Eimi wusste nicht so wirklich, was er von dem Plan halten sollte. Es wirkte wie etwas, das sich ein Kind ausgedacht hatte, und nicht nach dem Kopf der Schutztruppe.
Shin wandte sich dann zu Tsuru und berührte sie vorsichtig an ihrer Schulter.
„Es wird Zeit“, meinte er und gab ihr zu verstehen, dass keine Widerworte in Ordnung wären. Pecos nickte ihm zu. Dann sah er mit einem starken Funkeln in den Augen Tsuru an. In seinem Gesicht befand sich kein bisschen Angst. Er blickte Tsuru zuversichtlich und mutig an. Sein Blick ließ keine Zweifel daran, dass er sich Vaidyam stellen und ihn bezwingen würde. Es wurden keine Worte mehr getauscht, als Pecos mit Khamal in der Dunkelheit verschwand. Kurz darauf wurde es im Lager unruhig und alle bewegten sich in unterschiedliche Richtungen. Shin signalisierte Eimi, Tsuru und Ea, dass sie ihm folgen sollten.
Es ging los.
Kurz darauf liefen sie durch die Dunkelheit einen kleinen Trampelfad entlang. Während Shin damit beschäftigt war, die Kommunikationsgeräte, die er bei sich trug, eines nach dem anderen auszuschalten, versuchten Eimi und Tsuru über keine Steine zu stolpern. Sie kamen nur langsam voran, weil sie ohne Licht gehen mussten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Nachdem die Sonne untergangen war, verschwand mit ihr auch die letzte Wärme des Tages. Eimi wunderte sich, dass es in der Wüste nachts so kalt werden konnte. Oder war es nur so warm wie an einem üblichen Tag, ein starker Kontrast zur Hitze der Wüste?
Bald befanden sie sich auf einem Plateau etwas oberhalb von dem Ort, an dem sie bisher Rast gemacht hatten. Viele große und kleine Felsbrocken machten es nun noch schwieriger, voranzukommen. Deswegen quetschten sich die vier Personen an einigen vorbei, bis Shin ein Zeichen gab. Als sie zwischen den Felsen verharrten und Stille einkehrte, hörte man das entfernte Knistern eines Lagerfeuers. Neugierig wie Eimi, Tsuru und Ea waren, quetschten sie sich noch etwas weiter, um herauszufinden, wo sie waren. Sie fanden sich auf einer Anhöhe oberhalb eines großen Höhleneingangs wieder, der mindestens zwanzig Meter breit war, so schätzte Eimi. Hier oben bildeten die Felsen, zwischen denen die kleine Gruppe hervorlugte, eine merkwürdige Krone weit oberhalb des Höhleneingangs. Es war ein sicherer Platz, von dem aus Beobachter nicht erkannt wurden, wenn man nicht nach ihnen suchte. Shins Job war es sicherlich, von hier oben aus Nachrichten zu verschicken, wenn der Kampf startete.
Das Bild, das sich ihnen vor der Höhle bot, war merkwürdig. Etliche Fackeln befanden sich rund um den Höhleneingang und umrandeten eine freie Fläche, die wie ein Festplatz wirkte. In dessen Mitte befand sich eine Art Sänfte, ein Thron, auf dem Vaidyam saß. Um ihn herum wuselten seine Gruppenmitglieder geschäftig an Tischen und großen Kisten herum. Eimi erkannte die Frau mit den violetten Haaren namens Andme. Neben ihr arbeitete der kleine Mann mit der Brille namens Racun an mehreren chemischen Lösungen, die sich in unterschiedlichen Gläsern befanden. Auf der rechten Seite des Throns stand Borroka, das ehemalige muskelbepackte Mitglied von Pecos‘ Sondereinheit und beriet sich mit Vaidyam. Auf der linken Seite stand die junge Frau mit den drei Augen, die Eimi schon in Yofu-Shiti an Vaidyams Seite gesehen hatte.
Der Bereich außerhalb dieses Platzes war in Dunkelheit gehüllt. Dann entdeckte Eimi einen kleinen leuchteten Punkt. Als sich dieser näherte, erkannte er Khamal, der mit seinen Lichtfähigkeiten seinen linken Zeigefinger zum Leuchten brachte, während er mit der rechten Pecos hinter sich herzog, der gebeugt ging und so tat, als hätte er keine Kraft mehr. Pecos‘ Inszenierung war unfassbar glaubwürdig. Er stolperte über einen Stein, was darin resultierte, dass er sich einige Kratzer am Arm zuzog, als er zu Boden fiel. Khamal zerrte an ihm und half ihm wieder hoch, nur um ihn dann vor Vaidyams Füßen zu Boden zu treten, als sie auf dem Platz ankamen.
Vaidyam klatschte pathetisch in seine Hände.
„Na, sieh mal einer an, wen haben wir denn da? Pecos Guardador“, lachte er und bewegte sich von seinem Thron herunter. Seine Schritte waren langsam, bedacht, als würde er riechen, dass Gefahr in der Luft lag. Borroka knackste bedrohlich mit seinen Fingern. Die anderen stoppten für einen Moment mit ihren Beschäftigungen und sahen neugierig Vaidyam zu, der Pecos und Khamal näher kam.
„Du Dreckskerl!“, rief Pecos ihm zu.
Vaidyam ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Er klopfte stolz Khamal auf die Schulter, der wie immer keine Emotionen preisgab. Dann bückte er sich und streichelte mit seiner Hand über Pecos‘ Wange.
„So lange jagst du mich schon“, triumphierte Vaidyam und setzte dabei ein fieses Grinsen auf, „aber wie es scheint, bist du der Gejagte gewesen. Dank deiner großartigen Sondereinheit, die dich mehrmals hintergangen hat, bist du jetzt in meinen Händen.“
Vaidyam richtete sich wieder auf, drehte sich zu seinen Leuten und hob dabei seine Arme, als würde er einen Applaus erwarten. Dann, ohne dass jemand auch nur erahnen konnte, was als nächstes passierte, drehte er sich auf seinem Absatz wieder Pecos zu und trat ihm einmal gehörig gegen den Schädel. Pecos‘ Hut flog weg; er klappte zur Seite und Eimi sah nicht nur, wie aus seiner Schläfe nun Blut lief, sondern auch, dass Tsuru ihr Bestes gab, nicht zu schreien. Es musste schrecklich für sie sein, zu beobachten, was Pecos angetan wurde.
Pecos richtete sich wieder auf und lachte Vaidyam an. „Mehr hast du nicht drauf? Deine Tritte sind so schwach wie die von einer Siebenjährigen! Kein Wunder, dass du andere immer deine Drecksarbeit machen lässt.“
„Drecksarbeit?“, lachte Vaidyam höhnisch. „Als ob du verstehen würdest, wozu ich imstande bin! Oh, ich werde der größte Wissenschaftler der Welt! Ich werde diesen Planeten mit meinen Errungenschaften und Fähigkeiten erschüttern!“
„Du bist doch nichts mehr als ein eingebildeter Fatzke!“, beleidigte Pecos ihn, was Vaidyam so zur Weißglut brachte, dass er ihn wieder trat, diesmal in die Brust. Pecos rollte beiseite und röchelte nach Luft. Wie lange wollte er diese Tritte noch aushalten?
„Was hast du jetzt vor?“, fragte Pecos ihn.
„Nun ja, ich werde dich hübsches Kerlchen natürlich am Leben lassen“, erklärte Vaidyam. „Einfach nur damit du siehst, wie deine Welt zusammenbricht. Vor allem freue ich mich darauf, wenn ich deine kleine Freundin in die Finger bekomme. Sie hätte mir niemals entwischen dürfen.“ Den letzten Satz sprach er etwas leiser und mehr zu sich selbst. „Aber schau mal, was ich für dich vorbereitet habe!“
Vaidyam lachte wie ein Irrer und schnippte dann mit den Fingern, ein Signal, auf das das Mädchen mit den drei Augen reagierte. Sie wandte sich zur Höhle und kurz darauf traten Schatten aus ihr heraus. Im Licht der Fackeln erkannten nicht nur Pecos und Khamal, sondern auch Eimi, Tsuru und Ea, dass muskelbepackte Personen heraustraten. Es war kaum wahrzunehmen, welchen Geschlechts diese Personen waren. Ihre Körperproportionen waren auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen missgestaltet und verwachsen. Einigen dieser Leute wuchsen ungleichmäßige Haarbüschel aus dem Kopf, andere waren in zerrissene Laken gekleidet, manche waren oberkörperfrei. Dicke Adern zeigten sich unter der Haut und die Muskeln sahen unmenschlich groß aus. Es waren so viele dieser Personen, dass Eimi gar nicht in der Lage war, sie auf die Schnelle zu zählen. Tsuru hielt sich erschrocken eine Hand vor den Mund.
Pecos reagierte am schlimmsten darauf. Auf die Schnelle richtete er sich auf und hatte einen richtig wütenden Gesichtsausdruck.
„Was hast du nur getan!?“, brüllte er Vaidyam an. Diesmal reagierte auch Khamal und machte einen richtig erschrockenen Eindruck.
„Darf ich dir vorstellen? Das sind meine kleinen Babys“, grinste Vaidyam, ging zu einem dieser Muskelmonster und streichelte ihm zärtlich die Hand. „Vielleicht erkennst du den einen oder anderen ja wieder? In deiner Schutztruppe befanden sich einige freiwillige Personen, die sich gern zu meinen Experimenten bereit erklärten. Toll, nicht wahr? Was ein wenig Chemie alles so mit einem anstellen kann. Danke auch an meine bezaubernde Mirna, die durch ihre tolle Telepathie ein wenig nachhilft.“
Das waren also einmal echte Menschen gewesen? Mitglieder der Schutztruppe? Die als solche Missgestalten nun unter Vaidyams Fuchtel kämpfen sollten? Eimi wurde unglaublich wütend. In jedem dieser Monster sah er immer wieder das Bild der Frau aus dem Zug, die als Schwangere tot auf das Bett im Labor geschnallt war. Vaidyam musste hier und jetzt aufgehalten werden.
Doch in dem Moment, bevor Pecos sein Zeichen gab, schickte Vaidyam durch Mirna die Monster weg. Als Pecos „Jetzt!“ schrie, sprangen diese Experimente in alle Himmelsrichtungen davon. Pecos befreite sich von seinen Fesseln, zog seinen Revolver und begab sich mit Khamal in eine Kampfposition. Eimi sah, dass Shin schon längst durch seine Geräte mit den anderen Mitgliedern der Vastus Antishal und Schutztruppe kommunizierte, um allen Bescheid zu geben. Jetzt würde es gleich losgehen.
Was Eimi in diesem Moment aber am meisten überraschte, war, dass Ea zwischen den Felsen hervorsprang und sich nach unten stürzte. Er verwandelte im Flug seine Hände zu Felskrallen und kam unten mit einem harten Aufprall direkt zwischen Vaidyam und Pecos auf.
Pecos und Khamal nutzten die Sekunde der Verwirrung, um sich zusammen etwas besser zu positionieren. Als Ea sich aufrichtete und sich Vaidyam zeigte, lachte dieser wieder wie verrückt.
„Dachtet ihr etwa, ich habe nicht mitbekommen, was ihr vorhabt? Wo sich eure Freunde alle verstecken? Meine bezaubernde Mirna hat schon längst die ganze Umgebung gescannt und ratet mal, wohin ich meine lieben Babys geschickt habe! Und wen haben wir denn da? Mein liebstes Experiment ist zurückgekehrt.“
„Ich werde dich vernichten!“, brüllte Ea wütend.
Eimi hatte ihn noch nie so erlebt, nicht einmal damals im Labor.
„Gut, dass du da bist“, sagte Vaidyam nun ruhiger und fuhr sich mit seinen Fingern über sein Kinn. In seinen Augen brannte jedoch ein merkwürdiges Feuer. „Damals, als du mir entwischt bist, habe ich einen bitteren Preis bezahlt, musst du wissen. Aber Liade wird sich freuen, dass ich dich wiedergefunden habe. Er braucht dich für etwas Besonderes.“
„Mit deinen Experimenten ist nun ein für alle Mal Schluss!“, bedrohte ihn Ea und stürzte sich zusammen mit Pecos und Khamal in den Kampf.
Das gab nun auch Tsuru das Zeichen, sich nach unten zu begeben. Sie rannte los und Eimi folgte ihr, ohne, dass Shin beide aufhalten konnte.
Kapitel 61 – Verlieren
Es war ganz schön kalt, als Kioku so durch die Dunkelheit lief. Sie bemerkte, dass die feinen Härchen auf ihren Beinen und Armen sich aufstellten. Wie man es so machte, versuchte sie nervös, ihre Gänsehaut wegzureiben, um sich wieder wohlzufühlen. Sie bewegte sich vorsichtig vorwärts. Jeder Schritt hallte in einem merkwürdigen Echo wider, etwas, das darauf hindeutete, dass sie sich in einem Raum befinden musste. Sie streckte einen Arm aus und bewegte sich langsam weiter, um das Ende des Raumes zu finden, in dem sie sich befand.
Immer wieder fasste sie sich an die Stirn; Kopfschmerzen machten sich wieder bemerkbar, vor allem in dem Bereich ihrer Narbe. Langsam fuhr sie mit dem linken Zeigefinger die Wölbungen der Narbe ab, etwas, das sie sich sehr früh angewohnt hatte, um sich zu konzentrieren. Dieses Ritual diente ihr dazu, sich selbst wahrzunehmen und zu spüren. Mit wenig Druck fuhr sie die Narbe von oben nach unten ab. An dem unteren Ende ihrer Narbe spürte sie den Unterschied zwischen dem harten Narbengewebe und ihrer weichen Haut. Dann fuhr sie in entgegengesetzter Richtung wieder zurück.
Kioku wusste, dass diese Narbe niemals verschwinden würde. Früher oder später hatte sie also akzeptieren müssen, dass sie ein Teil ihres Selbst geworden war, welches sie dann nur noch wahrnahm, wenn andere sie danach fragten oder auf die Wunde starrten. Sie erinnerte sich daran, dass Alayna sie darauf angesprochen hatte, was sie zu ihrer eigenen Überraschung nie gestört hatte. Sie fand Alayna nie zu neugierig, was sicherlich daran liegen musste, dass sie Alayna schnell ins Herz geschlossen hatte. Sie war wie eine kleine Schwester, die Kioku selbst niemals gehabt hatte. Es tat richtig gut, ihr zu helfen und sie zu unterstützen.
Apropos klein – da war ja noch Tak. Als sie damals in Vernezye am Strand gesessen hatten und Kioku verzweifelt war, weil das Boot, das sie gefunden hatten, Ihr nichts bedeutete, hatte Tak sie motiviert, nicht aufzugeben. Er hatte ihr gesagt, dass sie sicherlich woanders Anhaltspunkte finden würde, wer sie war, wenn sie nicht aufgab. Diese Energie, die dieser Junge ausstrahlte, hatte sie seither stets motiviert. Sie wünschte sich vom ganzen Herzen, dass Tak bald seinen Vater finden würde.
So aufgedreht wie Takeru war, war Eimi eher ruhig und besonnen. Sie hatte anfangs an dem Jungen gezweifelt, war aber bald froh gewesen, dass er die Gruppe begleitete. Sie konnte sich stets darauf verlassen, dass Eimi etwas Ruhe in die Gruppe brachte und Kioku immer dabei unterstützte, Takeru und Alayna zu beschützen. Aber wann würde Eimi endlich einsehen, dass er in Alayna verliebt war? Es war so eine offensichtliche Sache, die Kioku schon sehr lange beobachtete. Vielleicht, ja, vielleicht, wenn das alles bald ein Ende fand, würde sie Eimi einen Stoß in die Seite geben und ihn darauf ansprechen, dass er sich doch endlich trauen sollte, Alayna seine Gefühle zu gestehen. Das klang nach einer perfekten Idee und so nahm sich Kioku das fest vor.
Erst, nachdem sie sich an ihre eigenen Gefühle zu erinnern versuchte, die sie so lange beiseite geschoben hatte, bemerkte sie, dass sie in der Finsternis stehen geblieben war. Kioku atmete einmal tief durch und schritt weiter, gefolgt von dem merkwürdigen Echo. Dann erkannte sie, als sich ihre Gedanken auf ihr eigenes Empfinden konzentrierten, dass diese undefinierbare Hitze in ihrer Brust schon sehr lange da war. Sie fühlte etwas für Anon. Vielleicht war es bald auch Zeit für sie, ihre Kraft zusammenzunehmen und Anon ihre Gefühle zu gestehen. Vielleicht war genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Wieder blieb sie stehen. Diesmal sah sie sich um. Ihre Freunde würden sie sicherlich bestärken und ihr versichern, dass es eine gute Idee war. Sie spürte Takeru vor sich, der mit mutig weit herausgestreckter Brust sagen würde, dass sie es schaffen konnte. Neben ihr fühlte sie Eimi, der unterstützend eine Hand auf ihre Schulter legte, um mit einem Lächeln zu bestätigen, dass sie auf dem richtigen Pfad war. Dann nahm sie die Wärme von Alaynas Hand in ihrer wahr, die zudrückte, um zu signalisieren, dass Kioku nicht allein war, nie allein war.
Jetzt musste sie nur noch Anon finden.
Sie schritt durch die Dunkelheit voran und obwohl sie nicht wusste, wo sie sich befand, wurde sie dabei immer schneller. Dabei dachte sie an all die Situationen, die sie mit Anon schon erlebt hatte, angefangen von dem ersten Mal, als sie ihn am Flughafen kennengelernt hatte, bis zu dem Moment, in dem er vor Schmerzen krümmend neben ihr lag. Jetzt musste sie sich beeilen. Sie spürte, dass Gefahr drohte; sie musste ihn schnell finden.
Ihr Herz fing an, stark zu pochen; ihre Atmung wurde schneller und bald erkannte sie, dass sie rannte.
Sie dachte sich, dass sie ihn finden musste.
Sie dachte sich, dass sie ihn nicht allein lassen wollte.
Sie dachte sich, wie unvollständig sie ohne ihn war.
‚Ich liebe ihn‘, dachte sie sich und hörte ihrer eigenen Stimme zu, die laut das widerhallende Echo im Raum ersetzte.
Erst jetzt erkannte sie in der Ferne einen unscharfen Lichtpunkt. Sie fixierte ihn und rannte darauf los, nun etwas leichter in der Brust, weil sie diesen Satz endlich ausgesprochen hatte, wenn auch nur in Gedanken. Dieser Satz war wie ein Schlüssel, der sie aus dieser Dunkelheit befreite. Das größer werdende Licht gab ihr Hoffnung Anon zu finden und es ihm endlich zu sagen.
Allmählich veränderte sich der Untergrund. Das Knirschen verriet, dass sie auf Kies und Sand zu laufen schien. Die Kälte kam nun nicht mehr von überall, nun nahm sie einen Windhauch wahr, der ihr aus einer Richtung entgegen blies. Obwohl dunkelgraue Wolken den Himmel verdeckten, war das wenige Licht, das die Umgebung erreichte, hell. Das Bild um sie herum wurde klarer und Kioku erkannte, dass sie an einer Küste entlang des Meeres lief. Vor ihr erhob sich wie ein dunkler Schatten eine felsige Klippe, die zu hoch war, um zu erkennen, was sich dort oben abspielte. Während sie weiterrannte, erkannte sie einen kleineren Schatten, der von dort hinabzufallen schien.
„Anon!“, rief sie und war erstaunt, wie laut ihre Stimme war, die ihren Mund verließ. Sie legte noch mal einen Zahn zu und sah, wie der Körper ins Wasser fiel und von Wellen umspült wurde. Sie musste sich beeilen, um ihm zu helfen, sonst ertrank er in den Wellen des Meeres.
Nahe der Stelle, wo der Körper in das Wasser eingetaucht war, sprang sie mutig hinein. Mit offenen Augen tauchte sie hinab in das eiskalte Wasser. In ihren Gedanken wiederholte sie, dass es ihr jedoch nichts ausmachte. In dem trüben, kalten Wasser des Meeres entdeckte sie dann den Schatten, der langsam zum Meeresgrund sank. Sie nahm all ihre Kraft zu zusammen und holte den Körper ein. Mit ihrem Arm fuhr sie um die Brust der Person und zog sie mit aller Kraft nach oben. Einige Luftblasen stiegen auf und leiteten ihr den richtigen Weg zur Wasseroberfläche, die in einem diffusen Licht aufleuchtete. Sie strampelte und gab all ihre Energie, um Anon aus dem Wasser zu retten. Es waren noch ein paar Meter, wenige Meter, dann nur noch Zentimeter, als sie die Oberfläche durchbrach und wieder Luft holte. Sie waren jedoch noch nicht sicher; Kioku musste die Person noch an das Ufer bringen. Also schwamm sie weiter, kämpfte gegen die Wellen an und bemerkte durch den Wind, der das Wasser in Wellen über die Meere schob, wie kalt es nun wirklich war. Es brauchte zwar eine Weile, bald aber spürte sie den Grund unter ihren Füßen und das Wasser wurde seichter. Die Wellen schlugen gegen ihren Rücken und drückten sie ans Ufer. Als sie richtig stehen konnte, wandte sie sich zu dem Körper, den sie hinter sich hergezogen hatte und packte ihn unter den Achseln. Es kostete sie fast all ihre Kraft, sie biss sich die Zähne zusammen und durch die Kälte und Anstrengung versagten ihr die Muskeln. Kioku zerrte den Körper mit der letzten Kraft, die sie sammeln konnte, an das Ufer und weg von dem Bereich, wohin die Wellen spülten. Sie wusste, dass sie nun erste Hilfe leisten musste, überprüfte die Atmung der Person und beatmete sie. Kurz darauf spuckte Anon Wasser, nahm kräftige Atemzüge und rollte sich vor Schmerz auf den Bauch, um das restliche Wasser aus ihrer Lunge zu husten.
Kioku war unfassbar beruhigt, dass sie Anon gerettet hatte und er lebte. Sie bot der Person ihre Hand an, sich aufzurichten, was jedoch abgelehnt wurde. Die Person setzte sich aufrecht auf. Erst jetzt, als sie die Sicherheit hatte, dass es ihr gut ging, erkannte Kioku, dass es sich nicht um Anon handelte. Um sicher zu gehen, dass sie richtig sah, schloss sie ihre Augen und öffnete sie wieder.
Kurze Zeit später saß Kioku und strich sich die klatschnassen, schwarzen Haare aus dem Gesicht. Als sie ein Brennen an ihrer Stirn spürte, tastete sie den Bereich ab. Sie blutete. Die Person, die vor ihr stand, hatte ebenfalls schwarze, nasse Haare und lächelte sie erleichtert an.
„Da habe ich dich aber vor dem Ertrinken gerettet“, sprach die Frau, die etwa im gleichen Alter wie Kioku zu sein schien.
„Habe ich nicht dich ge…“, murmelte Kioku verwirrt vor sich hin. Sie war richtig außer Atem und fror wie ein Schlosshund. „…rettet? Wer bist du?“
„Ich bin Aoko“, sprach die Frau und sah sie ebenfalls verwirrt an.
Dann wurde Kioku eine Hand angeboten und sie stand auf und sah sich noch einmal um. „Aoko? Den Namen habe ich schon einmal gehört.“
„Wer bist du?“, fragte Aoko nach.
„Ich heiße Kioku. Danke, dass du mich gerettet hast“, bedankte sie sich.
„Was machst du hier eigentlich?“, hakte Aoko nach.
„Ich suche Anon“, erklärte Kioku als sie das Gefühl beschlich, dass Aoko ihn kannte.
„Anon? Er ist wirklich ein netter Kerl. Er hat mir auch schon geholfen, meine Mutter zu suchen“, erklärte Aoko.
„Deine Mutter?“
Verwirrt sah sich Kioku um, konnte aber nichts entdecken, was ihr irgendwie verriet, was eigentlich geschah.
„Ja, ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ich vermisse sie so sehr“, sprach Aoko. Ihre Stimme hörte sich so unfassbar vertraut an; Kioku konnte aber nicht wirklich zuordnen, wo sie diese Stimme schon einmal gehört hatte. Auch ihr Aussehen fühlte sich für Kioku vertraut an.
„Woher kommst du?“, wollte Kioku wissen und ging einige Schritte, in der Hoffnung, dass Anon bald auftauchen würde.
„Wir sind Reisende. Meine Mutter und ich suchen seit einiger Zeit nach unserer Familie. Sie hatte ihre Familie vor langer Zeit verloren.“
„Das ist traurig. Das tut mir wirklich leid.“
„Schon gut. Wir haben oft Probleme mit Leuten, die aus irgendeinem Grund hinter uns her sind. Aber Mutter möchte mir nicht verraten, wieso“, erklärte Aoko weiterhin und folgte Kioku.
Sie liefen gemeinsam in irgendeine Richtung. Das Rauschen des Meeres wurde immer leiser und verschwand bald. Kioku fiel nicht auf, dass sie zurück in die Dunkelheit liefen. Sie nahm sie nicht mehr wahr.
„Aoko heißt du?“, fragte Kioku noch einmal. „Irgendwie kommt mir dein Name sehr bekannt vor. Haben wir uns schon einmal getroffen?“
„Ich befürchte nicht.“
„Woher kennst du Anon?“, erkundigte sich Kioku, während sie nicht aufhörte, die Umgebung nach Anzeichen für Anons Verbleib abzusuchen.
„Ich weiß nicht. Er war einfach da“, erklärte sich Aoko und suchte mit. „Ich finde ihn ganz nett. Woher kennst du Anon?“
„Er hat meinen Freunden und mir schon oft geholfen. Und ich … ich …“, stammelte Kioku. Dabei griff sie mit ihren Händen nach dem unteren Ende ihres Oberteils und spielte damit herum; eine Geste, die man oft bei nervösen oder schüchternen Menschen sah.
„Du bist verliebt, richtig?“, erkannte Aoko. War es so offensichtlich, dass selbst fremde Leute erkannten, wie ihre Gefühle gegenüber Anon waren? Oder steckte mehr dahinter, dass Aoko, die Anon ebenfalls kannte, das wusste?
Etwas Zeit verging, Kioku konnte nicht sagen, wie viel. Dann fand sich Kioku in Begleitung Aokos vor einem Licht wieder, das wie eine leuchtende Sphäre über dem Boden zu schweben schien. Diese Lichtkugel hatte etwas merkwürdig Lebendiges an sich.
Abwechselnd sah sie die Sphäre und Aoko an. Erst jetzt erkannte sie, dass Aoko eine Narbe an ihrer linken Schläfe hatte, die frisch blutete. Aoko hatte ähnliche Haare wie sie und plötzlich wurde ihr klar, wieso Aokos Stimme so vertraut war.
Es war ihre eigene Stimme.
Kioku öffnete ihren Mund, um Aoko zu fragen, ob sie Kioku war, die andere Kioku, nach der sie selbst so lange gesucht hatte, aber kein Ton kam mehr heraus. Sie sah wieder zur Sphäre und sah Anon neben sich liegen. Ein menschlicher, bedrohlicher Schatten näherte sich ihm.
Sie hörte auch keine Stimme mehr aus Aokos Mund, obwohl sie ihn bewegte. Nun stand sie zwischen beiden Personen. All die Fragen, die sie in den letzten Jahren gehabt hatte, traten nun wieder in ihre Gedanken. Sie fühlte sich so, als würden diese Fragen hinausdringen wollen und Antworten von Aoko haben wollen. Aber sie stand auf einmal tonlos da und Kioku konnte sie einfach nicht mehr verstehen. Dann war da aber noch Anon neben ihr und eine Gefahr schien Anon etwas antun zu wollen.
Sie musste sich entscheiden.
Schnell.
Warum musste sie sich entscheiden?
Schnell, verdammt.
Wollte sie Fragen stellen, um herauszufinden, wer Aoko war?
Jetzt!
Wollte sie Anon retten, den Mann, den sie liebte?
Beide Seiten standen vor ihr und es zerriss sie förmlich.
Dann packte sie all ihren Mut zusammen.
Sie entschied sich.
Sie trat in die Lichtkugel.
Als Kioku ihr Bewusstsein wiedererlangte, packte der Mann namens Miraa Anons Hand. Die leuchtend roten Augen des Mannes machten Kioku Angst. Das Grinsen auf Miraas Gesicht nahm monströse Züge an.
Dann sah sie zu, wie Miraa Anon das Band stahl. Anon krümmte sich vor Schmerz, als sie beobachtete, wie das Band unter seinen Klamotten pulsierte und sich auf eine Art und Weise bewegte, wie sie es noch nie beobachtet hatte. Es schwoll an und gewann ein besonderes Eigenleben, das abstrakt war. Das Hemd, das Anon trug, platzte an einigen Stellen auf und Kioku erkannte, wie das Band wie tausend Schlangen sich um Anons Körper wandte, als würde es versuchen, sich gegen den Einfluss Miraas zu wehren. Anon schrie vor Schmerz und Kioku schrie, dass es aufhören sollte.
„Anon!“, rief sie und wollte sich aufstützen, bemerkte aber, dass sie kaum mehr Kraft hatte.
Nafsu schien Kiokus Versuch zu bemerken und wollte das um jeden Preis verhindern. Also nahm sie ihren Speer und schlug damit auf Kioku ein. Kioku krümmte sich vor Schmerz und versuchte sich wegzurollen; Nafsu ließ aber nicht locker. Die scharfkantigen Steine des Untergrunds rissen ihr Kratzer in Arme und Beine. Der staubige Dreck und der Sand klebten auf ihren kleinen Wunden. Anons Schreie ließen nicht nach. Er lag immer noch auf dem Boden und wehrte sich gegen die Macht Miraas.
Kioku öffnete ein Auge und sah, wie das Band sich erst um Miraas Finger, seine Hand und dann seinen Arm wickelte. Der Stoff pulsierte und schien in einem dunklen, violetten Licht zu leuchten. Das Band verließ Anons Körper und ließ einen blassen, mager wirkenden Körper zurück, der von den wenigen Fetzen seiner Klamotten bedeckt war, die noch übrig geblieben waren.
Dieser Anblick brachte Kioku zum Weinen. Tränen quollen aus ihren Augen hervor und während sie sich auf ihre Unterarme stützte, wandte sich Nafsu von ihr ab und trat zu Anon.
„Was tust du da!?“, rief Kioku und befürchtete das Schlimmste.
Nafsu jedoch ließ sich nicht ablenken und kniete vor den schwachen Körper Anons, fuhr mit ihren Fingern über seinen Körper, als würde sie jede Linie und jeden Muskel darauf genau untersuchen. Anon schien sich dagegen nicht wehren zu können.
„Anon, sprich zu mir!“, forderte Kioku, um herauszufinden, wie schlecht es ihm gerade ging. Aber sie bekam keine Antwort. Dann nahm sie noch mehr Kraft zusammen und robbte langsam in seine Richtung. Ihr ganzer Körper schmerzte unglaublich, bis auf die Stellen, die schon längst taub waren. Und plötzlich schien sie für ihre Feinde nicht mehr zu existieren. Nafsu wandte sich von Anon ab und ging daraufhin zu Miraa, der das Band, welches nun um seinen Arm gewickelt war, genau studierte.
„Lange habe ich darauf gewartet, dich wiederzufinden“, sprach er, mehr zu sich selbst als zu Nafsu. „Endlich habe ich meine Waffe wieder!“
Ein teuflisches Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit, als er das Band kontrollierte und damit herumspielte. Für einen Moment ließ er das Band mit einer unfassbaren Geschwindigkeit auf einen naheliegenden Felsen schnellen, der in tausend Teile zerschmettert wurde. Kioku sah dabei nur fassungslos zu, als einige kleine Splitter sie und Anon trafen. Mittlerweile stützte sie sich über ihren Freund, um seinen Körper vor neuen Angriffen zu schützen.
„O Meister“, schmachtete Nafsu Miraa an, „endlich ist es so weit, dass Sie den nächsten Schritt Ihres Planes angehen können.“
„Meine Schönheit“, antwortete er, dabei war der Klang seiner Stimme unheimlich, „ich werde diese Götter fesseln und eine neue Welt erschaffen.“
Dann nahm er seine Hand und fuhr Nafsu über die Wange. Er hielt ihr Kinn fest, als würde er sie besitzen.
„O Meister“, flüsterte Nafsu nun. Sie schien wie verzaubert zu sein. Es wirkte fast so, als wäre sie ihm mit jeder Zelle ihres Körpers verfallen, fast, als wäre sie verliebt. Dann war ein kleines Quieken ihrerseits zu hören.
„Finde die Kinder. Finde die Götter“, befahl er ihr. Dann beobachtete Kioku, wie sich das Band um seine Brust wickelte und große Tentakeln formte, die von seinem Rücken kamen. Eines der Bänder schnappte sich Eimis Schwert, das immer noch am Höhleneingang lehnte. Diese riesigen Tentakeln hoben Miraas Körper nach oben, der nun über dem Boden zu schweben schien. Dann sah Kioku zu, wie er sich von Nafsu abwendete und wie eine gigantische Spinne über die Felsformationen kletterte und dahinter verschwand.
Nafsu streckte einen Arm nach Miraa aus, als würde sie ihn noch festhalten wollen. Dann schien sie den Moment des Abschiedes zu genießen. Ihre Hände fuhren zu den weiblichen Stellen ihres Körpers und ihre Körperhaltung verriet eine merkwürdige Erregung. Wie auch immer die Beziehung zwischen ihr und Miraa war, Kioku verstörte es ungemein.
Kioku versuchte, keinen Mucks von sich zu geben, um so wenig Aufmerksamkeit auf sich und Anon zu ziehen. In dieser Weile konnte sie sich ihm etwas nähern, doch bevor sie Anon erreichte, wandte Nafsu sich den beiden wieder zu.
Wie sollte Kioku Anon nun beschützen, der kraftlos neben ihr lag und sich selbst nicht mehr wehren konnte? Sie musste sich einen Trick einfallen lassen und das schnell.
„Ist er nicht der schönste Mann, den ihr jemals gesehen habt?“, träumte Nafsu vor sich hin. Sie rammte ihren Speer in den Boden und lehnte sich verträumt daran an. „Diese Stärke, diese Macht!“
„Du scheinst ja wirklich begeistert von ihm zu sein“, entgegnete Kioku. Wenn sie selbst schon nur noch wenig Kraft zu kämpfen hatte, musste sie zu anderen Mitteln greifen. Wenn sie Nafsu verbal ablenkte, konnte sie vielleicht eine Schwachstelle herausfinden. „Ich meine, was habt ihr überhaupt vor?“
„Oh, du kleines Würmchen. Aoko, Kioku, wie auch immer du heißt, du wirst nicht würdig sein, seine Welt zu sehen“, warf sie Kioku vor und kicherte verträumt in den Nachthimmel hinein.
„Von was für einer Welt sprichst du überhaupt?“, wunderte sich Kioku. Sie rutschte etwas näher an Anon, sodass Nafsu ihn weniger bemerkte.
„Eine schöne Welt wartet auf mich, voller schöner Menschen und Frieden“, erklärte Nafsu, als würde sie über eine großartige Tat schwärmen, die Miraa schon vollbracht hatte. „Er schafft eine Welt wie in der Antike, vor tausenden von Jahren als die Welt noch schön und nicht überbevölkert und die Natur unberührt war. Er setzt den Zustand der Welt wieder auf das Level, das sie haben sollte. Rohe, harte Natur mit ihrer Schönheit und Pracht trifft auf friedlich lebende Menschen. Miraa schafft einen Kontrast und eine Symbiose, welche die Welt seit sehr langer Zeit schon nicht mehr gesehen hat.“
„Von was redest du?“, wunderte sich Kioku, als sie zögerlich versuchte sich aufzurichten. Dabei achtete sie darauf, dass sie keine zu hastigen Bewegungen machte, um Nafsu nicht zu provozieren. „Die Welt ist schön“, widersprach Kioku ihr. „Es passieren so schöne Sachen, die Welt ist doch in Ordnung, wie sie ist.“
War sie das? Nachdem sie diesen Satz ausgesprochen hatte, zweifelte sie etwas daran. Die Realität war, dass sie in einer Welt lebte, in der Städte gebrandschatzt wurden, in der sich Menschen zu Gruppen zusammenfanden, um Kriege zu führen. Menschen wurden misshandelt und Experimente an ihnen ausgeführt. Frieden war ein Wunsch, kein Status.
Warum also empfand sie die Worte Nafsus als etwas Schlechtes? Was war denn falsch daran, eine Welt zu erschaffen, die aus Frieden bestand?
„Ach, du findest das schön?“, wunderte sich Nafsu, griff nach ihrem Speer und lachte höhnisch. „Schau dir doch dieses Würmchen an, das dort liegt!“
Sie deutete auf Anon und in dem Augenblick, als Kiokus Blick ihrem Finger folgte, war sie für eine Sekunde so abgelenkt, dass Nafsu ihr einen kräftigen Schlag auf ihren Oberschenkel verpassen konnte. Kioku knickte ein und lag wieder auf dem Boden. Der Schmerz brannte durch ihren ganzen Körper und schien sie für einen Moment zu paralysieren.
Dann ging Nafsu auf Anon zu, griff seine Haare und zog seinen Kopf etwas in die Höhe. Ihr Gesichtsausdruck sah merkwürdig aus. Kioku konnte nicht erkennen, ob sie angewidert oder fasziniert aussah.
„Das nennst du schön?“, lachte Nafsu nun wieder. „Er hätte niemals das Band meines Meisters tragen dürfen. Er wertschätzt die neue Welt nicht, die Miraa Liade schaffen wird. Er gehört nicht zu den Leuten, die Frieden verdient haben. Und den Rest der Welt, das findest du schön? Kriege, Hunger und Hass, die auf jedem Kontinent dieses Planeten Einzug halten und den Menschen einen nach dem anderen das Leben kosten? Glaubst du wirklich, du bist auf der richtigen Seite dieses Kampfes, kleine Aoko?“
Dann fuhr sie mit ihrem Finger wieder über den schwachen Körper Anons. Es widerte Kioku an, zu sehen, was sie mit Anons Körper machte. Und wieder sprach sie Kioku mit diesem Namen an.
Aoko.
Sie wusste zwar nun, wer Aoko war, aber sie wusste nicht, wer sie war. Hatte Anon sie wirklich getroffen? Kioku musste herausfinden, warum er sie vor ihr selbst beschützen wollte. Aber zuerst musste sie ihn irgendwie vor Nafsu beschützen. Also stemmte sie sich mit aller Kraft wieder auf die Beine. Mittlerweile spürte sie kaum mehr etwas, weil alles durch den pulsierenden Schmerz taub geworden war.
„Oh ja, es passieren so viele schlimme Dinge, die man am liebsten vergessen würde“, fing Kioku an, „aber es passieren auch gute Dinge! Menschen sind in der Lage, sich zu verändern und sich zu bessern. Was auch immer ihr damit meint, eine neue Welt zu erschaffen, das kann nicht richtig sein!“
„Wenn du nur wüsstest“, widersprach ihr Nafsu und stand auf. Plötzlich wirkte sie ziemlich erzürnt. „Wir knechten die Götter und erschaffen eine Welt ohne Hass und ohne Leid. Was kann denn schöner sein als das?“
„Es gehört einfach dazu! Es gehört einfach dazu, dass man sich schlecht fühlt und leidet. Das ist das Leben. Schlimme Dinge passieren nun einmal!“ Kioku sprach sich nun richtig in Rage. So viele schlimme Dinge waren in ihrem Leben sicherlich passiert. Wenn sie sich doch nur daran erinnern würde. Wie brachte sie sich dazu, zu erinnern, wer Aoko war? „Aber wenn man Gutes tut und sich mit Menschen umgibt, die Gutes tun, dann wird die Welt wieder in Ordnung sein! Den Menschen, denen Leid zugefügt wird, muss zugehört werden. Ihnen muss geholfen werden!“ So fühlte es sich an, Alayna und Takeru zu unterstützen. Sie selbst hatte sich in einer Notsituation gesehen, als sie die Geschwister kennengelernt hatte. Aber unvoreingenommen hatte sie den beiden ihre Hilfe angeboten. Kioku war stolz darauf, diese Entscheidung getroffen zu haben. „Jeder Mensch, der allein ist, verdient es, Hilfe zu bekommen!“ Oder war es nicht eher so, dass Alayna und Takeru ihr geholfen hatten? Ihr einen Grund gegeben hatten, ihre Reise nicht abzubrechen? Und war es nicht Anon, der sie die ganze Zeit schon zu beschützen versuchte? Versuchte er auch, Aoko zu schützen? Was auch immer Anon erlebt hatte, sie war dankbar für alles, was er für sie tat. „Daraus entsteht Liebe! Liebe, die für Freunde und besondere Menschen brennt. Wenn das Licht der Liebe nur durch die Welt getragen wird, dann wird die Welt schon von allein in Ordnung gebracht werden!“ Sie fasste nun neuen Mut. Egal, wie dieser Kampf für sie ausgehen würde, sie war sich jetzt sicher, dass ihre Dankbarkeit gegenüber ihren Freunden und die Liebe, die sie in sich trug, alles wieder gutmachen würde. Sie konnte Anon nicht böse sein, dass er ihr Aoko verschwiegen hatte. Wie denn auch? Vielleicht wusste er selbst nicht, wie er mit dieser Situation umgehen sollte. Aber jetzt musste sie sich darauf konzentrieren, ihn zu beschützen, denn …
„Ich liebe Anon! Also lass ihn gefälligst in Ruhe, sonst lernst du Kioku erst richtig kennen!“, gestand sie und fühlte sich, als diese Worte ihre Lippen verließen, mächtiger denn je.
Sie rannte mit dem Kopf voraus auf Nafsu zu, die ihren Speer schon längst zum Schlag ausholte. Gerade, als Kioku sich auf Nafsu stürzen wollte, schien Nafsu zum Schlag bereit zu sein, jedoch blieb ihr Speer im Boden stecken. Kioku rammte ihren Kopf in Nafsus Magen und sah erst, als beide zu Boden stürzten, dass Anon aufgestanden war und Nafsus Speer nun fest in seinen Händen hielt. Er atmete schwer, wahrscheinlich weil er immer noch kaum Kraft hatte. Er sah sie mit einem siegessicheren Blick an, sagte jedoch nichts zu dem, was Kioku gerade laut ausgesprochen hatte.
Ihr Herz raste plötzlich schneller als jemals zuvor. Dann packte Nafsu Kiokus Haare und zog daran, während Kioku versuchte, Nafsu von sich zu stoßen. Kioku schrie vor Schmerz auf und wusste nichts Besseres zu tun, als etwas Dreck vom Boden zu nehmen und es Nafsu direkt ins Gesicht zu drücken. Dann holte sie mit ihrer Faust aus und schlug Nafsu mitten ins Gesicht. Sie schrie vor Schmerz ebenfalls auf und stieß Kioku mit ihren Beinen von sich herunter. Nafsu richtete sich dann auf und tastete erst verwundert ihr Gesicht ab. Blut rann aus ihrer Nase, die nun gebrochen war und in einem falschen Winkel zur Seite zeigte.
„Du kleine Schlampe!“, schrie Nafsu plötzlich und wollte sich auf Kioku stürzen, fiel aber zu Boden. Als Anon ihr mit dem Speer ein Bein stellte. Schnell versuchte er, sie mit dem Speer zu schlagen; Nafsu rollte jedoch zur Seite. Mittlerweile lag der goldene Schmuck, den Nafsu in ihren Haaren trug, auf dem Boden. Ihre Haare standen zerzaust von ihrem Kopf ab. Mehrmals versuchte sie, sie zu richten, als wäre sie ständig damit abgelenkt, schön aussehen zu müssen. „Das wirst du bereuen!“
„Werden wir sehen“, grinste Kioku, die nicht mehr wirklich gerade stehen konnte, weil der Schmerz, der in heftigen Wellen immer wieder kam, ihren Gleichgewichtssinn durcheinander brachte. Anon stützte sich auch auf den Speer, damit er stehen konnte. Die Situation schien nicht gerade gut für die beiden zu stehen, aber irgendetwas gab Kioku das Gefühl, dass sie das schon schaffen würden.
Der Moment, als sich Nafsu die Haare richtete, nutzten die beiden, um für einen kurzen Moment durchzuatmen. Dann begab sich ihre Feindin wieder in Kampfposition und lachte manisch.
„Ich werde euch am Leben lassen“, versprach Nafsu den beiden. „Damit ihr seht, wie eure ach so schöne Welt niedergerissen wird und zuseht, wie ich in eine schöne, neue Welt geboren werde, die niemals für euch bestimmt sein wird!“
„Wir werden dich und Miraa Liade aufhalten“, sprach nun Anon bestimmt. Seine Stimme hatte ein verletztes Kratzen, was Kioku zeigte, dass er wirklich am Ende seiner Energien war. „Und werden dich einsperren und dich zusehen lassen, wie wir diese Welt verändern.“
Im nächsten Augenblick schien für Kioku alles wie in Zeitlupe abzulaufen. Die drei rannten aufeinander zu; mit geballten Fäusten wollten sie sich treffen. Anon schrie los, um die letzten Kräfte zu kanalisieren und Kioku tat es ihm gleich. Dann, kurz bevor sie aufeinander trafen, erkannte Kioku aus dem Augenwinkel einen Schatten zwischen den Felsen hervorspringen und plötzlich fiel Nafsu zu Boden. Weil sie und Anon ihren Angriff nicht zu Ende ausführen konnten, fingen beide an zu taumeln und zu stürzen. Jedoch warf sich Anon so zu Kioku und nahm sie während ihres Sturzes so in den Arm, dass sie nicht hart auf dem Boden aufkam, sondern weich auf ihn fiel, weil er ihren Sturz abfederte. Ein tonloses Ächzen verließ Anons Körper, der den Schmerz, den er während des Sturzes spürte, nicht verstecken konnte.
Während Kioku sicher ging, dass sich Anon nicht noch schlimmer verletzt hatte, richteten sich beide auf und sahen nach, was passiert war.
Eine Frau mit grünen Haaren und Morgensternen als Waffe stand über Nafsu und hatte sie überwältigt. Zwei weitere Personen, die offensichtlich zur Schutztruppe und zu den Vastus Antishal gehörten, was Kioku an den Ansteckern ihrer Klamotten erkannte, fesselten Nafsu.
„Das werdet ihr bereuen!“, kreischte sie nun, als sie versuchte, sich zu wehren. Die Schutztruppler brachten weitere Fesseln an ihren Beinen an.
„Momogochu!“, stellte Anon erstaunt fest. Dabei drückte er mit einer Hand auf seine Brust.
Momogochu von den Vastus Antishal zeigte ihm einen Daumen nach oben. Dann ließ sich Anon wieder zurück auf den Boden fallen. Das Licht des Fackeln färbte seine Haut in ein besonderes Orange. Kioku war sich noch nicht sicher, dass sie nun in Sicherheit war, ließ sich aber einfach auch wieder zu Boden fallen. Ihr nächster Atemzug schien lang zu sein, als würde sie versuchen jedes Sauerstoffmolekül aufzusaugen, das sich in der Luft befand. Am Nachthimmel waren die ersten Sterne zu sehen.
„Momogochu ist ein Mitglied der Vastus Antishal“, erklärte Anon leise. „Sie wird sich um Nafsu kümmern.“
Dann tauchten auf einmal mehrere Mitglieder der Schutztruppe und auch der Vastus Antishal auf und brachten Nafsu weg, deren laute Beschwerden hinter den Felsen schnell zu leisen Nichtigkeiten verstummten.
„Wir brauchen einen Med!“, rief Momogochu. „Ein Team soll die Höhle inspizieren; wir schlagen erst einmal ein Untersuchungslager auf.“ Plötzlich kamen weitere Personen, die sich um Anon und Kioku kümmerten. Mittlerweile waren beide so schwach, dass sie die Untersuchungen einfach über sich ergehen ließen. „Wir sind Unterstützung für Pecos‘ Mission“, hörten sie Momogochu erklären. „Da ist die Verstärkung wohl zum richtigen Moment eingetroffen!“
So langsam klärten sich Kiokus Gedanken und sie realisierte, was sie gerade erlebt und vor allem was sie gerade gesagt hatte. Obwohl sie sich gerne von Anon weggedreht hätte, damit er nicht sehen konnte, dass sie rot anlief, konnte sie ihren Blick von ihm nicht losreißen. Sie hatte gesagt, dass sie ihn liebte. Ob er es gehört hatte? Sie war sich nicht sicher, aber nicht mutig genug, um nachzufragen. Ihr Herz hörte nicht auf zu rasen. Dann wurde er auf eine kleine Trage gelegt und in die Höhle befördert. Im Anschluss wurde auch sie auf einer Trage in die Höhle gebracht, in der in Sekundenschnelle eine kleine Notfallstation aufgebaut wurde.
Kapitel 62 – Der Kompass
Als Gaara seine Geschichte beendet hatte, die er wie in Trance erzählt hatte, kehrte für einen Moment, der sich ewig anfühlte, Stille ein. Durch die Höhlengänge war ein entferntes, unbestimmtes Rauschen wahrzunehmen, so leise, dass man es fast nicht hörte. Irgendwo löste sich ein feuchter Tropfen und fiel zu Boden.
Wie die Geschwister erfuhren, starb Gaara in seinem über viertausend jahrelangen Leben etliche Male. Wie es sich wohl anfühlen musste, zu sterben, fragte sich Takeru.
Dieses große Puzzleteil erklärte das Ende des Tagebuchs. Shiana, Ea und Laan schienen Götter zu sein, die ebenfalls so lange am Leben sein mussten, wie es Gaara tat. Außerdem wurde erklärt, dass der Mann namens Miraa die Welt radikal erneuern wollte – durch ihre komplette Vernichtung. Takeru wunderte sich, ob er auch der Mann war, für den Toni gearbeitet hatte. Fasziniert sah Takeru zu der Frau mit den blauen Haaren. Von ihr ging eine magische Präsenz aus. Was für Geheimnisse sich noch hinter dieser Frau versteckten? Am liebsten würde er noch weiter in dieser Höhle sitzen und sich alle Geschichten erzählen lassen, die es zu erzählen gab. Dann schweifte sein Blick durch die Runde und er stellte fest, dass jede der anwesenden Personen diesen Moment der Ruhe brauchte, um ihre Gedanken neu zu sortieren.
Obwohl Takeru erwartete, dass Riven sich als erstes zu Wort meldete, weil er gerade noch so gedrängt hatte, loszuziehen, um Miraa endgültig zu besiegen, sprach als erste Shiana.
„Ich erinnere mich auch wieder“, sagte sie und nickte Gaara und Ginta zu. „Ich hatte so viel vergessen, aber jetzt erinnere ich mich an vieles wieder. Als du damals in dieser Nacht aufgetaucht bist, habe ich dich nicht danach gefragt, was du im Krieg erlebt hast.“
„Mach dir keinen Vorwurf“, entgegnete Gaara und sah sie mit traurigen Augen an.
„Ich hätte es tun sollen“, warf sich Shiana vor.
„Es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt.“
„Es ist immer der richtige Zeitpunkt, jemanden zu fragen, wie es ihm geht“, sagte sie in einer ruhigen, aber bestimmten Art und Weise.
Darüber hatte Takeru noch nie nachgedacht. Er ging immer davon aus, dass, wenn es jemanden nicht gut ging, derjenige das schon mitteilen würde. Er sah in die Runde und überlegte sich, wann er seinen Vater oder seine Schwester das letzte Mal wirklich gefragt hatte, wie es ihnen ging.
„Jetzt, nachdem Gaara seine Geschichte erzählen konnte, haben wir gehofft, dass du dich vielleicht auch erinnerst, was damals passiert ist?“, wandte sich Ginta an Shiana.
„Wir sollten nicht so viel Zeit verschwenden, uns Geschichten zu erzählen“, wandte Riven nun erzürnt ein. „Miraa muss jetzt vernichtet werden, bevor größeres Unheil passiert.“
„Riven, du weißt, dass uns jeder Hinweis hilft“, wies ihn Jumon zurecht. „Ich brauche diese Information, bevor ich die Kinder zurück in die Stadt bringe.“
„Lass uns nur noch diese Information hören“, beschwichtigte ihn Ginta. „Dann legen wir sofort los.“
Stimmt, dachte sich Takeru. Sein Vater war der beste Streitschlichter, den er jemals kennengelernt hatte. Er wusste immer genau, wann er sich in einen Streit zwischen Takeru und seiner Schwester einmischen musste und wann nicht. Es waren die großen Streitereien, die sein Vater mit seinen ruhigen Worten immer schnell entschärfen konnte.
Jetzt sagte Riven nichts mehr. Mit seinem verbundenen Gesicht wirkte er sehr unheimlich, aber dennoch war deutlich zu erkennen, dass er großen Respekt vor seinem Vater hatte. Das fand Takeru gut, denn er wollte das Ende der Geschichte ebenfalls erfahren.
Dann wandten sich alle wieder Shiana zu, die sich zu erinnern versuchte.
„Ich erinnere mich nur an wenig“, sagte sie zögerlich, „Aber ich weiß, dass vor unserer letzten Schlacht Uzryuuk auf die Idee kam, dass diese Visionen, die ich hatte, Ausschnitte aus der Zukunft sein könnten. Wenn ich die Zukunft sähe, dachte sie, dann könne ich vielleicht auch eine Tür dahin öffnen. Und wir trainierten im Geheimen. Irgendwann funktionierte es. Ich konnte sie, Servant und Natoku in eine Zukunft schicken, in der sie eine wichtigere Rolle spielen würden.“
„Als ich sie auf meiner Reise kennengelernt habe“, verstand Ginta. „Sie hatten alle eine wichtige Rolle, mich auf meinem Weg zu unterstützen. Ich habe sie alle auf meiner Reise damals kennengelernt. Servant übergab mir das Amulett. Natoku trainierte mich und Uzryuuk half mir, den richtigen Weg zu finden.“
„Das waren die Aufgaben, die sie in der Zukunft zu erledigen hatten“, fügte Shiana hinzu.
„Du hast es also ermöglicht, sie in die Zukunft zu schicken? Eine Zeitreise?“, wunderte sich Jumon und schien sich in ein kleines Notizbuch, das er in seiner Hosentasche hatte, etwas zu notieren.
Shiana nickte. „Ich hatte jeden von uns in einer Zukunftsvision gesehen, deswegen hegte ich den Plan, im letzten Kampf eine Tür zu öffnen und uns dorthin zu bringen. Jeden Einzelnen, weil ich gesehen hatte, dass in der Zukunft eine Möglichkeit existiert, wie wir Miraa aufhalten können. Aber irgendetwas ist schiefgelaufen.“
„Ich habe gesehen, wie dich Laan in deine Tür gestoßen hat“, kommentierte Gaara. „Bevor mir das Licht ausgegangen ist.“
„Aber was ist mit den beiden danach passiert?“, wunderte sich Shiana und sah besorgt in die Runde. Das war also der große geheime Plan, den Shiana in dem Tagebuch beschrieben hatte. Sie hätten alle durch die Zeit reisen sollen. Jetzt waren sie hier und hatten sich noch nicht gefunden, dachte sich Takeru.
„Ea und Laan sind hier!“, verkündete er. Er fühlte sich danach, etwas Wichtiges beitragen zu können. „Wir haben sie gesehen. Ea ist mit uns gereist und wir haben Laan mit dem Kompass aus einer Art Dimension befreit. Außerdem, können wir nicht einfach Miraa noch weiter in die Zukunft schicken, sodass er hier keine Gefahr mehr ist?“
„Also haben es beide geschafft?“, wunderte sich Shiana und ein leichtes Lächeln zauberte sich auf ihre Lippen. „Aber das mit der Zeitreise ist nicht so einfach. Das verlagert das Problem nur und löst es nicht, richtig?“, kommentierte Jumon.
„Ich denke?“, murmelte Takeru unsicher, weil er nicht genau wusste, wie er diese Frage beantworten sollte. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, ständig durch die Zeit zu reisen, überlegte er sich.
Sein Vater sah Shiana auch unschlüssig an. Dann fiel ihm wieder etwas zu Ea ein. „Ich weiß nur, dass Ea etwas davon erwähnt hatte, nach über viertausend Jahren seinen Freund wiederzusehen.“
„Aber wenn er durch das Portal gekommen ist, kann er nicht so alt sein“, erklärte Gaara. „Außer, er hat es nicht durch das Portal geschafft und hat tatsächlich tausende Jahre gewartet. Der Arme. Dann hat er das gleiche durchgemacht wie ich.“
„Ich möchte das in Erfahrung bringen. Ich möchte Ea und Laan treffen“, wünschte sich Shiana und sah erwartungsvoll in die Runde.
„Ginta, wir müssen jetzt wirklich aufbrechen“, forderte Riven nachdrücklich. Anscheinend hatte er genug von dem vielen Reden und wollte endlich handeln.
„Papa, ich kann euch helfen. Mit dem Kompass habe ich Laan schon zweimal gefunden“, merkte Takeru an.
Sein Vater verharrte nachdenklich und kratzte sich am Kinn, wie er es immer tat, wenn er über etwas grübeln musste.
Alayna beschlich eine merkwürdige Angst. Zeitreisen über tausende Jahre in die Zukunft – was bedeutete das? Sie selbst würde durchdrehen, wenn sie das machen müsste. Außerdem vermutete sie, dass Shiana und Gaara Gefühle füreinander hatten und abertausende Jahre hatten warten müssen, um sich wiederzusehen. Wie herzzerreißend das war. Diese Gedanken stimmten sie zum einen traurig und zum anderen verwirrten sie sie noch mehr. Jetzt hatten sie endlich ihren Vater gefunden und das Erste, was sie mitbekamen, war, dass durch eine rituelle Opferung ein viertausend Jahre alter Mann wiedergeboren wurde, der in eine Göttin verliebt war, die durch Zeitreisen die Welt vor einem ebenfalls viertausend Jahre alten Freund des Wiedergeborenen Mannes retten wollte. Ihr Vater wusste darüber alles und unterstützte diesen Plan, weil er auf irgendeine Weise mit all dem verbunden war.
Dann fragte sie sich, was ihr Vater sich nun für einen Plan ausdenken würde. Sie selbst wollte gern zurück zu Kioku und Eimi, um ihnen alles erzählen zu können, was vorgefallen war. Und jetzt, nachdem sie ihren Vater gefunden hatten, wollte sie ihre Mutter aufsuchen, um herauszufinden, wie es ihr ging. Das war ein guter Plan. Aber würde ihr Vater es wirklich in Erwägung ziehen, Takeru mitzunehmen, weil er den Kompass irgendwie bedienen konnte?
Dann, nach einer kurzen Zeit, die Riven damit verbracht hatte, mit seinem Fuß nervös auf den Boden zu tippen, löste sich ihr Vater aus seiner nachdenklichen Starre und hatte anscheinend einen Entschluss gefasst.
„Wir machen es folgendermaßen: Jumon, du nimmst Tak und Alayna bitte mit zurück in die Stadt. Riven, Gaara, Shiana und ich werden unseren Plan verfolgen und Miraa aufsuchen.“
„Aber Papa!“, protestierte Takeru, „ich kann mit dem Kompass helfen!“
„Mir ist mehr damit geholfen, wenn ich weiß, dass du in Sicherheit bist“, erwiderte Ginta. „Wenn es wirklich wahr ist, dass ihr auch nur ein Fünkchen Genkioken in euch tragt und Miraa davon erfährt, werdet ihr ein Ziel von ihm sein.“
Riven nickte bestätigend. Unter seinem Verband konnte man kaum Gefühlsregungen erkennen, aber Alayna wusste, dass er sehr froh über diese Entscheidung war. Sie selbst war es auch.
„Außerdem, behalte den Kompass. Jumon wird auf euch aufpassen, sodass ich weiß, dass er nicht abhanden kommt. Falls es stimmt, dass Ea und Laan euch aufsuchen werden, um den Kompass einzusammeln, wird Jumon da sein und beide aufklären, wie die Situation ist.“
„Aber ich möchte dir wirklich helfen“, flehte Takeru und zerrte an den Klamotten seines Vaters, wie er es früher auch schon immer getan hatte.
In dem Moment, als der Gesichtsausdruck ihres Vaters ernster wurde, stieg in Alayna ein beklemmendes Gefühl hoch, weil sie wusste, was darauf folgte. Obwohl es nicht um sie ging, zuckte sie dennoch kurz in sich zusammen.
„Keine Widerrede!“, wurde ihr Vater laut. Dann packte er Takeru an den Schultern, um seinen Worten noch mehr Stärke zu verleihen. „Wenn ich sage, dass du mit deiner Schwester zurück in die Stadt gehst, dann tust du das! Verstehst du immer noch nicht, dass das hier kein Spiel ist?!“
Takeru erstarrte im Griff seines Vaters. Alayna schluckte, denn sie mochte die zornige Version ihres Vaters wirklich gar nicht. Ein kleiner Teil ihrer Persönlichkeit stimmte den Worten ihres Vaters zu. Es war hier kein Spaß; der Untergang der Welt stand auf dem Spiel. Sie wusste aber auch, dass ihrem Vater ihre Sicherheit besonders wichtig war.
Sie sah, wie Takerus Augen glasig wurden, er jedoch ein Weinen unterdrückte.
„Hör zu“, meinte ihr Vater plötzlich in einer leiseren, viel liebevolleren Stimme. Dann drückte er seinen Sohn an sich heran. „Es tut mir leid, Tak. Aber das alles hier ist so gefährlich. Ich brauche dich einfach in der Stadt. Zum einen, damit du deine Schwester beschützen kannst und zum anderen, damit du auf den Kompass aufpasst, bis er gebraucht wird. Schaffst du das?“
Ihr Vater konnte einfach nie lange wütend sein. In diesem Augenblick fühlte sie, wie sehr sie ihn vermisst hatte. Sie widerstand jedoch dem Drang, auf ihn zuzugehen und ihn zu umarmen. Es war gerade irgendwie der falsche Moment dafür. Aber sie wusste, dass sich das bald ändern würde.
„Papa hat recht“, stimmte sie seinen Worten zu. „Lass uns zurück in die Stadt gehen. Eimi und Kioku warten sicherlich schon auf uns.“
„Außerdem wäre es gut herauszufinden, was mit Ea und Laan im Anschluss passiert ist, richtig? Das könnte dein Job sein, Tak“, erklärte Jumon, um den Jungen etwas zu beruhigen.
Takeru nickte, sagte aber kein Wort mehr. Alayna wusste, dass er sich der Entscheidung seines Vaters sicherlich bald widersetzen würde, aber gerade schien er sich damit abzufinden.
Ihr Vater drückte Takeru und sie zum Abschied. Er flüsterte ihr bei der Umarmung zu, dass sie auf ihren Bruder und sich aufpassen sollte.
„Entschuldige alles“, sagte er noch ganz leise.
Dann signalisierte Jumon den anderen zu gehen und lief mit den Geschwistern zurück in den Gang, aus dem sie vorher gekommen waren. Eine merkwürdige Stille sorgte für eine bedrückte Stimmung. Sie nahmen ihre Sachen, pressten sich durch die Felsspalte wieder nach draußen und verließen die Höhle. Draußen angekommen bemerkte Alayna, dass der Sandsturm sich gelegt hatte und ein prächtiger Nachthimmel zu sehen war.
Der erste Atemzug an der kalten Luft fühlte sich besonders für Alayna an. Sie genoss die frische Luft, als würde sie für einen Moment ihre Gedanken reinigen. Sie wusste, wie schwer es ihrem Bruder fallen musste, ihren Vater nun wieder zu verlassen. Eine so lange Zeit hatten sie damit verbracht, ihn zu finden. Jetzt, durch einen so besonderen Zufall, hatte Takeru recht gehabt und an der Stelle, an der er ihren Vater vermutet hatte, hatten sie ihn tatsächlich gefunden. Sie wollte es selbst nicht gern zugeben, aber irgendwie fühlte sich das viel zu leicht für sie an. Während sie so darüber nachdachte, wie das Verhalten all der Freunde ihres Vaters und das Geheimnis, dass er sich hier befand, zusammenhing, betrachtete sie ihren Bruder. In der Dunkelheit der Nacht sah sie eine Träne auf seiner Wange. Weinte er? Dann spürte sie etwas auf ihrer Wange und tastete vorsichtig danach. Es war nass. Auch sie weinte. War das Erleichterung? Erleichterung darüber, dass sie nun weniger Verantwortung trug?
Aber das stimmte nicht. Beide Geschwister hatten immer noch eine wichtige Rolle. Sie mussten zurück in die Stadt, Ea und Laan finden, die Artefakte in Sicherheit bringen und dann wollte sie ihre Mutter finden. Trotzdem fiel es ihr nicht leicht, ihren Vater jetzt wieder zu verlassen. Wie es nur Takeru ging? Sie brauchte ihn nicht danach zu fragen, um zu spüren, wie es ihn bewegte. Sie wünschte sich einfach nur, dass er auf ihren Vater hörte.
Takeru interessierte der sternenklare Himmel nicht, an dem man Sternbilder sah, die man sonst in der Stadt selten zu Gesicht bekam. Es war überraschend kalt und wie seine Schwester rieb er sich die Oberarme; ein kläglicher Versuch, sich selbst aufzuwärmen. Dabei beobachtete er Jumon, der eine Tasche schulterte, aus der oben die Ecke eines Buches herausschaute.
Er griff sich an die Brust, die Stelle, an der der Kompass hing, hielt ihn fest und dachte nach. Dass sich durch die Zeitreise das Problem nur verlagerte, war für ihn sinnhaft. Er konnte nachvollziehen, dass sich dadurch das Problem nicht löste, weil es schon einmal so nicht geschehen war. Shiana meinte, sie hatte in der Vergangenheit eine Vision davon gehabt, dass sich alle Beteiligten in einer Zukunft befanden. Aber woher wusste sie, dass es im Jetzt war? Was, wenn das alles in einer noch ferneren Zukunft spielen würde? Was war ihr Beweis?
Während Takeru so darüber nachdachte, was die Lösung für das Problem sein könnte, ging Jumon los und schaute ständig hinter sich, um zu überprüfen, dass die Geschwister ihm auch hinterherkamen. Er folgte langsam einen Pfad, der von dem Plateau aus, auf dem sie sich befanden, in Richtung der Stadt zurückführte. Die kleinen und großen Felsbrocken erschwerten das Laufen, vor allem auch deshalb, weil man in der Dunkelheit der Nacht oft auch einen Stein übersah. Was Takeru jedoch ins Auge fiel, während er so nachdachte, waren die vertrockneten Pflanzen, die entfernt an Kakteen erinnerten, die wie schmerzverzerrte Gestalten zwischen den Felsen hervorlugten und aussahen wie nach Wasser suchende kleine Menschen.
Vielleicht machte es aber auch Sinn, die Macht der Artefakte und der Götter im Jetzt dafür zu nutzen, diesen Mann namens Miraa auszuschalten – für immer. Aber wie ging das? Ea und Laan müssten das Schwert und den Kompass zurückbekommen. Dann könnten sie doch ihre Macht entfesseln und Miraa besiegen, oder nicht? So einfach war das! Wie gern er jetzt an der Seite seines Vaters gewesen wäre. Natürlich enttäuschte es ihn, dass er so kurz, nachdem er seinen Vater gefunden hatte, schon wieder von ihm getrennt war, aber irgendwie sah er schon ein, dass die Aufgabe, die er jetzt hatte, ebenfalls wichtig war. Dieser merkwürdige Zwiespalt seiner Gefühle verklärte seine Konzentration.
Der Weg wurde immer unzugänglicher. Der einfache Trampelpfad wich einem Gelände, das nun aus größeren Felsbrocken bestand. Jumon ging ganz langsam voraus und warnte die beiden vor, sie sollten vorsichtig sein, man würde so wenig sehen. Währenddessen wünschte Takeru sich, Laan und Ea zu finden. Wenn er die beiden treffen würde, könnten sie ihrem Papa direkt zu Hilfe eilen und die Welt retten.
Gerade, als sie sich auf einer etwas offeneren Ebene befanden, die sich auf einer verschachtelten Anhöhe aus Plateaus und Wänden befand, passierte etwas Unkontrolliertes. Was Takeru nicht wusste, war, dass der Wunsch, Ea und Laan zu finden, den Kompass, den er mit sich trug, aktivierte. Zunächst glimmte ein schwaches Licht unter seinem Shirt, das immer stärker wurde, bis letztendlich ein viel zu starker Lichtstrahl gen Himmel strahlte.
„Takeru!“, rief Jumon und stürmte auf ihn zu, als er das Licht bemerkte. „Was machst du da!?“
„Der Kompass, er leuchtet einfach!“, verteidigte er sich und holte ihn unter seinem Shirt hervor. Er strahlte nun noch viel stärker. „Wir können zu Papa zurück und ihm zeigen, wo Laan und Ea sind!“ Takeru wusste, dass sein Vorschlag Jumon jedoch nicht überzeugen würde.
„Wieso machst du das jetzt?“, wunderte sich seine Schwester und beobachtete, wohin der Strahl zeigte.
„Lass das sein, bevor uns noch jemand entdeckt, der uns nicht entdecken soll“, warnte ihn Jumon, der sich besorgt in der Gegend umsah.
„Wer soll uns denn entdecken?“, hakte Alayna nach und sah sich ebenfalls um. „Wir waren hier bisher ziemlich einsam unterwegs. Hier sollte doch niemand sein.“
„Die Geister der Gegend sind sehr unruhig. Sie spüren, dass etwas in den Schatten lauert“, war Jumons Antwort. Takeru erinnerte sich, dass eine von Jumons besonderen Fähigkeiten war, Geister zu sehen. Jumon sagte das in einem so bestimmten Ton, dass keines der Geschwister etwas dagegen sagen wollte.
„Tschuldigung“, verteidigte sich Takeru, „es hat sich einfach aktiviert.“ Er versuchte verzweifelt, das Leuchten aufzuhalten, aber da es keinen Aus-Knopf gab, ging das nicht so einfach. Deswegen schüttelte Takeru den Kompass, was dafür sorgte, dass der Lichtstrahl umhertanzte und so wahrscheinlich noch viel mehr Aufmerksamkeit erregte. Einmal schüttelte er ihn sogar so, dass der Lichtstrahl direkt in sein Auge zeigte und ihn somit blendete, aber statt den Kompass von sich wegzudrehen, hielt er sich erstmal die andere Hand vor die Augen; eine Reaktion, die er nicht bewusst steuerte.
Dann, plötzlich, hielt Jumon jeweils Alayna und Takeru an der Schulter fest und sah sie mit einem Blick an, der bedeutete, in Stille innezuhalten.
„Ich habe etwas gehört“, flüsterte er in einer fast nicht mehr wahrnehmbaren Lautstärke.
Takeru fror in seiner Bewegung ein und versuchte zu lauschen. Es war so unfassbar still, denn bis auf den Wind war nichts zu hören. Dann hörte man auf einmal ein undefinierbares Geräusch, welches Takeru nicht zuordnen konnte. Schritte? Ein fallender Stein? Er wusste es einfach nicht.
Hatte Jumon recht und es befanden sich noch andere Personen hier? Was aber, wenn es sein Vater war, der zufällig den gleichen Weg ging, wie sie?
„Schnell, pack ihn weg“, flüsterte Jumon und hielt Takeru seine Tasche hin, sodass er den Kompass dort hineinlegen konnte. Aber Takeru weigerte sich, den Kompass aus seinem Besitz zu geben. War es nicht die Anweisung seines Vaters gewesen, er solle auf den Kompass aufpassen? Und diese Aufgabe wollte er auch verantwortungsvoll übernehmen.
Also schüttelte er den Kopf, um zu signalisieren, dass er das nicht machen würde und steckte den Kompass dafür in seine Hosentasche. Da er durch den Stoff immer noch hindurchleuchtete und das Licht stark genug war, dass man die drei in der Dunkelheit erkennen konnte, presste Takeru beide seine Hände auf die Stelle, wo der Kompass war. Dennoch war ein Licht wahrzunehmen.
Jumon gestikulierte umher, was Takeru so interpretierte, dass er es für eine dumme Idee hielt. Alayna bemerkte das und fing auch an, ihre Hände auf Takerus Hosentasche zu legen.
Aber es half nicht. Das Licht war immer noch deutlich zu erkennen.
Also schob Jumon die Hände der Kinder beiseite, um an den Tascheninhalt zu gelangen. Takeru sah Jumon mit ernsten Augen an und hielt den Arm des Mannes fest, sodass er sich nicht den Kompass holen konnte. Was sollte das? Wollte Jumon den Kompass nun mit Gewalt nehmen?
Takeru wehrte sich und formte mit seinen Lippen stumme Flüche, was Jumon animierte, noch energischer zu werden. Alayna jedoch wollte mit diesem Streit nichts zu tun haben, ging einige Schritte zurück und sah dem ganzen Geschehen verwundert zu. Sie gestikulierte mit den Armen, um zu signalisieren, dass sie das doch sein lassen sollten.
„Takeru!“, flüsterte Jumon laut.
„Ich kann ihn dir nicht geben!“, wehrte sich Takeru, der durch seine geschlossenen Zähne sprach, um leiser zu sein, jedoch einen bestimmteren Ton zu haben.
Beide hielten inne, als plötzlich ein Stein zu hören war, der von irgendwo herunterzufallen schien. Sie sahen sich um und konnten in der Dunkelheit nichts erkennen. Dann jedoch hörten sie ein merkwürdiges Heulen, das zwischen den Felsbrocken zu einem diffusen Echo verzerrt wurde.
„Was ist das?“, wunderte sich Takeru und sah Jumon fragend an.
„Ist das ein Wolf?“, hakte Alayna nach, die sich den beiden wieder näherte.
Das Heulen wiederholte sich, dem ein merkwürdig klingendes Lachen folgte.
„Das kann kein Wolf sein“, erklärte Jumon. „Da ist jemand, der aber nicht wie ein Freund klingt. Schnell, kommt.“
Jumon wandte sich in die entgegensetzte Richtung, aus der sie die Geräusche wahrnahmen. Er schien noch eine merkwürdige Handbewegung zu machen, die die Geschwister nicht deuten konnten. Takeru drückte wieder die Hände auf die Stelle mit dem Kompass, der nicht aufhörte zu leuchten.
„Da ist jemand!“, hörten sie plötzlich eine Stimme rufen. Kurz darauf hörten sie mehrere Schritte.
„Scheiße!“, flüsterte Jumon und sah sich panisch um. „Wir müssen uns verstecken! Kümmer dich darum, dass der Kompass aufhört zu leuchten.“
„Aber wer sind die!?“, wollte Takeru wissen.
„Das ist niemand von unseren Leuten, das kann ich dir versichern“, meinte Jumon nur und suchte die Gegend nach einem passenden Versteck ab. An einer Stelle schienen die Felsen groß genug zu sein, dass man sich, wenn man sich dahinter kauerte, gut verstecken konnte.
„Dahin, los!“, befahl Jumon und zeigte auf die Stelle, die in der Dunkelheit der Nacht einfach nur wie ein großer Schatten aussah.
„Da sind sie!“, rief jemand in der Ferne.
„Ich sehe sie auch!“, antwortete jemand darauf.
„Hinterher!“, befahl noch eine Stimme.
Kurz darauf war ein weiteres Heulen zu hören. Nun sprinteten Jumon, Alayna und Takeru los. Es war noch ein Stück bis zu der Stelle, auf die Jumon gedeutet hatte. Die Schritte hinter ihnen wurden immer lauter und wurden begleitet von Zurufen und einer Art Kriegsgebrüll. Takeru fühlte sich plötzlich wie Jagdbeute und das Schlimme daran war, dass dieser blöde Kompass einfach nicht aufhörte, zu leuchten. Warum jetzt? Weil er sich wünschte, Laan zu sehen? Gerade wünschte er sich einfach nur, dass dieses Ding aufhörte zu leuchten damit man sie nicht entdeckte.
Plötzlich stolperte Takeru und purzelte über den felsigen Boden. Jumon und Alayna bemerkten dies nicht und liefen weiter. Takeru verkniff sich einen schmerzhaften Ausruf und biss sich deshalb auf die Unterlippe. Er hatte sich das Schienbein an einem scharfen Stein gestoßen und als er es abtastete, spürte er Blut. Beim Aufstehen stach der Schmerz übel in seinem Unterschenkel in alle Richtungen. Er durfte den Anschluss an Jumon und seine Schwester nicht verlieren, deswegen richtete er sich schnell wieder auf; dabei sah er sich kurz um und sah im Dunkeln etwas auf ihn zurennen. Er konnte nur das Weiß im Auge der Person erkennen.
Ihn packte plötzlich die Angst; noch nie hatte er sich so schnell erschreckt und so nahm er seine Beine in die Hand, um Jumon und Alayna zu folgen. Doch im Dunkeln sah er nicht mehr, wohin sie gelaufen waren – er war doch derjenige, der durch den Kompass beleuchtet wurde. Selbst das bisschen Licht, das aus seiner Hosentasche leuchtete, blendete ihn in der Dunkelheit der Nacht, dass die Schatten um ihn herum noch unschärfer wurden.
Als er loslief, war er sich auch nicht mehr so sicher, ob er in die richtige Richtung rannte. Die Schritte der Person waren ganz nah. Er versuchte dabei sein Bestes, auf dem schwierigen Untergrund aus verschieden großen Felsbrocken, die teilweise locker auf dem Boden lagen, voranzukommen. Noch einmal stolperte er; diesmal rutschte er über eine sandige Stelle auf einem relativ großen, flachen Stein aus. Die Person hinter ihm kam näher und er spürte, dass es keine freundliche Person sein konnte. Diesmal stieß sie wieder ein Geheule aus, das er zuvor als Wolfsgeheul missverstanden hatte. Außerdem schien die Person merkwürdig zu hecheln. Dachte sie etwa, dass sie ein Wolf wäre? Takeru wollte nur noch weg von hier und in Sicherheit gelangen. Wer waren diese Leute überhaupt? Was machten sie in diesem Gebirge und warum jagten sie ihn jetzt? Nur weil der Inhalt seiner Hosentasche etwas leuchtete? Hätte es nicht auch eine Taschenlampe sein können? Wussten sie, dass es der Kompass war?
Seine Gedanken wurden wieder von dem Schmerz in seinem Schienbein unterbrochen. Es tat schrecklich weh. Dann vermutete Takeru hinter zwei Schatten, die wie Felsen aussahen, eine Bewegung gesehen zu haben. Waren das Jumon und Alayna? Er wollte nicht nach ihnen rufen; das würde sicherlich den Leuten verraten, wo sie waren. Wenn er schon nicht schnell genug war zu fliehen, dann wollte er wenigstens bei Alayna und Jumon sein. Falls es zu einer kämpferischen Auseinandersetzung kam, wollte er nicht allein sein. Also rannte er schnurstracks auf die Stelle zu, bei der er vermutete, dass seine Schwester und Jumon waren.
Die Person hinter ihm heulte wieder auf wie ein Wolf; daraufhin schienen die anderen Personen mit Zurufen und Gejubel zu reagieren. Takeru rannte so schnell er konnte; gleich hatte er es geschafft. Hinter den zwei Felsen würde er eine scharfe Kurve nach rechts machen; vielleicht gab es dann eine Möglichkeit, seinen Verfolger loszuwerden – oder zumindest zu verwirren. Er spürte, als sich seine Nackenhaare aufstellten und ein unangenehmes Kribbeln seine Wirbelsäule entlangfuhr, dass die Person hinter ihm immer näherkam. Warum hatte die Person ihn nicht schon längst eingeholt?
Es waren nur noch ein paar Meter bis zu der Stelle mit den Felsen. Takeru nahm noch einmal all seine Energie zusammen und gab richtig Gas. Der Abstand verringerte sich, dann waren es nur noch zwei Meter. Ein Meter. Er schlug mit einer Hand auf den Fels auf seiner linken Seite, wie als müsste er sich selbst beweisen, dass er es geschafft hatte.
Gerade als er eine scharfe Kurve machen wollte, spürte er keinen Boden mehr unter sich.
Bevor er verstand, was passierte, befand er sich schon im freien Fall.
Sein Körper wirbelte etwas umher, es war ihm kaum möglich, gen Himmel zu sehen. Ihm war übel und schwindelig zugleich. Sein Atem blieb ihm weg, weswegen er nur einen stummen Schrei von sich geben konnte. Der Lichtstrahl, der gen Himmel zeigte, beleuchtete die Person, die ihn verfolgt hatte. Für eine Bruchteil einer Sekunde konnte er im grünlichen Licht erkennen, dass es sich um eine Frau mit drei Zöpfen handelte, deren Gesichtszüge aggressiv waren und ihn Fall packte. Hatte sie sich einfach absichtlich von der Anhöhe gestürzt, um ihn zu fangen? Takeru schrie jetzt auf, als sie ihn festhielt. Er strampelte mit den Beinen, ein kläglicher Versuch etwas gegen das Fallen zu unternehmen.
Beide rangelten als beide auf dem Boden aufkamen und die Körper voneinander wegrollten.
Kapitel 63 – Der Albtraum
Sie hatte keinen Namen. Die Frau aus dem Zug hatte keinen Namen. Eimi hatte ihn nie erfahren, nicht, als sie entführt worden war und auch nicht, als er ihre Leiche im Labor gefunden hatte. Alle Frauen, die dort gestorben waren, hatten keinen Namen. Aber sie hatten Familie und Freunde, da war sich Eimi sicher. Sie hatten alle ein Leben und eine Geschichte. Dieser Gedanke begleitete ihn nun schon eine Weile.
Als er sich zwischen den Felsbrocken abstützte, um Tsuru nach unten zum Geschehen zu folgen, versuchte Shin, der sich hinter beiden befand, sein Bestes, sie von ihrem Plan abzuhalten.
„Ich muss Pecos einfach helfen!“, bestand Tsuru daraufhin und bemühte sich, noch schneller voranzukommen.
„Pecos meinte ausdrücklich, dass du Vaidyam nicht in die Hände fallen darfst!“, versuchte Shin sie zu überzeugen, was aber offensichtlich nichts half. „Deine Fähigkeit ist zu mächtig!“
Sie antwortete nicht, kletterte dafür aber mittlerweile so schnell, dass Eimi nicht hinterherkam. Er trug das neue Schwert unter seinem Poncho, an der Stelle, an der er das alte getragen hatte. Für einen Augenblick fasste er an die Stelle, um das kalte Metall an seinen Fingerspitzen zu fühlen. Eimi war überaus glücklich über dieses Geschenk, spürte aber auch eine unfassbare Verantwortung gegenüber dieser Waffe. Wie Tsuru ihre Liebe beschützen wollte, wollte auch er beschützen. Das bedeutete stark zu sein, sich seinen Ängsten und seinen Gegnern zu stellen. Wie anders sollte er denn diesen unheimlichen Schatten bezwingen, der ihn seit den Ereignissen während der Zugfahrt und des Eindringens in das Labor verfolgte?
Deswegen musste er Tsuru und Pecos unterstützen. Es musste Eimi sein, der Vaidyam bezwang und auch er musste es sein, der diesem Wahnsinn ein Ende setzte. Nur war er sich einfach noch nicht sicher, wie er das anstellen sollte.
„Eimi, du musst sie aufhalten!“, riss Shin ihn aus seinen Gedanken. „Wenn Vaidyam und seine Leute sie und ihre Fähigkeit in die Finger bekommen, könnte es das Ende sein!“ Shin kam ihm näher und hielt ihn an seiner Schulter fest. „Eimi, denk doch einmal nach. Pecos hat einen perfekten Plan …“
„Du wirst sie nicht aufhalten können“, sagte Eimi ruhig und wandte sich wieder zum Gehen. Er wusste auch nicht genau, was die Worte, die er gerade sagte, zu bedeuten hatten. Vielleicht meinte er damit nicht einmal Tsuru, sondern sich selbst. Dann drängte sich Shin an ihm vorbei. Er musste gemerkt haben, dass auch Eimi keine Hilfe war, Tsuru von ihrem Vorhaben abzuhalten. Sofort versuchte Shin Tsuru einzuholen. Es hatte aber keinen Zweck mehr.
Der Abstieg endete an einer Stelle, unweit der Stelle, an der Pecos auf Vaidyam traf. Tsuru befand sich auf dem Pfad, von dem Pecos vorher gekommen sein musste. Der steinige Untergrund wich einem Pfad, der aus fester Erde und nur wenigen Steinen bestand. Von hier war es leichter, wieder zurück zu der Stelle zu kommen, wo sich die Höhle von Vaidyam befand.
Eimi folgte als letzter und beobachtete, wie Tsuru sich kein einziges Mal umdrehte. Ihr Blick musste fest auf ihr Ziel fixiert sein. Shin hingegen schnappte sich eines seiner kleinen metallenen Geräte, die er an seinem Gürtel befestigt hatte und kontaktierte andere Schutztruppler.
„Wir brauchen Verstärkung an Punkt B-18“, sprach er in das Gerät. „Ich wiederhole: Wir brauchen Verstärkung an Punkt B-18. Gruppen C und J sollen sich mobilisieren. Gruppen G bis I verweilen bitte an ihren Standorten.“
Dann wiederholte Shin seine Anweisungen, bis er das Gerät wieder an seinem Gürtel befestigte. Es konnte nicht mehr weit zu der Stelle sein, wo sich Vaidyam und Pecos befanden. Eimi sah schon das Licht der Fackeln hinter einigen großen Felsen leuchten.
Tsuru nahm ihre Beine in die Hand und rannte los. Gerade als Eimi jedoch hinterherwollte, blieb er erschrocken stehen. Ein riesiger Schatten sprang aus der Dunkelheit von Tsurus linker Seite auf sie zu und packte sie. Zusammen mit einer riesigen Person rollte sie über den Boden.
„Tsuru!“, schrie Eimi und stürmte auf beide zu. Er zog dabei sein Schwert, das ihm immer noch zu schwer war. Auch Shin zog sein Schwert, welches zwei Klingen hatte. Die fast weiße Farbe des Metalls blitzte in der Dunkelheit auf.
Dieser gigantische Fleischberg, der sich auf Tsuru gestürzt hatte, war sicher einer dieser verunstalteten Personen, die Vaidyam gerade eben noch in alle Himmelsrichtungen geschickt hatte. Tsuru ließ einen Kampfschrei los und Eimi sowie Shin schlugen beide mit den stumpfen Enden ihrer Schwertgriffe auf den Fleischberg ein, von dem ein unfassbar ekliger, stechender Geruch ausging. Das war ein Geruch, den Eimi noch nie in seinem Leben gerochen hatte und nun auch nicht zuordnen konnte. Er konnte sich aber nicht wegdrehen oder sich die Nase zuhalten und musste diesen Gestank aushalten, während er versuchte, Tsuru zu befreien.
Für einen Augenblick schien dieser monströse Mensch abgelenkt zu sein und Tsuru schaffte es, aus seinem Griff hinauszugleiten. Dann robbte sie rückwärts über den Boden, um ein wenig Abstand zu ihm zu bekommen. Mittlerweile holte dieser Riese mit seinem muskulösen Arm aus, auf dem sich die Adern wie Bergkämme abzeichneten. Mit einem Schlag schaffte er es, Eimi und Shin einige Meter von sich wegzustoßen. Tsuru nutzte die Gelegenheit, um auf dem Boden einige Steine zu einem langen Steinhammer zu fusionieren. Sie nahm ihre neue Waffe fest in die Hand, holte aus und verpasste der Person einen mächtigen Schlag ins Gesicht. Der Schmerzensschrei, den die Person losließ, brummte mit einem tiefen Bass. Sie hielt sich ihr Gesicht und taumelte verwirrt umher.
„Tsuru geht es dir gut!?“, wollte Eimi wissen und richtete sich vom Boden wieder auf. Er stützte sich auf sein Schwert und beobachtete das Monster aus der Ferne.
„Alles gut!“, antwortete sie, „mir ist nichts Schlimmes passiert.“
„Wir müssen dieses Ding bezwingen!“, forderte Shin, der sein Schwert fest in beiden Händen hielt, bereit dazu, einen Angriff zu starten.
„Aber da steckt eine Person drin“, stellte Eimi fest und sah sich seinen Gegner noch einmal genau an. „Eine Person, die auch nur Opfer der Experimente von Vaidyam geworden ist!“
„Eimi hat recht“, stimmte Tsuru ihm zu. „Wir dürfen ihn nicht verletzen. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, die Person da drin zu retten.“
„Was sollen wir jetzt eurer Meinung nach tun?“, wunderte sich Shin, der wie die beiden zusah, wie sich die riesige Person wieder aufrichtete und sie zielsicher anstarrte, wie ein Raubtier, das gerade etwas reißen wollte.
„Ich weiß nicht, können wir ihn nicht irgendwie bewusstlos machen?“, grübelte Tsuru, dabei spielten ihre Finger mit dem Griff ihres Hammers.
„Nach dem Motto: Hau den Lukas? Also verpassen wir ihm einmal mächtige Kopfschmerzen, sodass er Sterne sieht“, fügte Eimi hinzu, zweifelte jedoch daran, wie er das nur anstellen sollte. Sein Schwert war zum Schneiden gedacht; das und der fehlende Schwerpunkt machte es so schwierig, es wie einen Hammer zu benutzen. Das ging mit Eas Schwert so viel leichter. Was keine Klinge hatte, konnte auch nicht schneiden.
Ohne Vorwarnung stürmte die Person nun auf Shin und Eimi zu. Bei jedem Schritt bebte der Boden und Eimi sah, wie kleine Kiesel durch die Erschütterung vom Boden abhoben.
Die Person nahm kräftig an Geschwindigkeit auf und Eimi machte sich bereit. Sein Plan war einfach beiseite zu springen und sie dann von hinten anzugreifen, jedoch wurde er durch das Beben abgelenkt und war er nicht schnell genug; die Person rammte ihren Schädel mit aller Gewalt in Eimi, den es an seiner Seite traf. Er rollte sich beiseite und hielt mit schmerzverzerrtem Gesicht seinen Bauch. Shin hatte es geschafft auszuweichen und stürzte sich nun mit Tsuru auf die Person. Tsuru holte mit ihrem Hammer aus und Shin wollte mit seinem Schwert angreifen, da drehte sich die Person schnell herum und stieß beide mit einem kräftigen Stoß beiseite. Dann ging der Schrank wieder in die Knie und wirkte so, als würde sie wieder mit dem Kopf voraus auf die Gruppe zurennen wollen.
Eimi wusste, dass es bei so einem Angriff nicht möglich war, mit einer Waffe zu parieren. Irgendetwas musste er sich einfallen lassen. So ging das für ein paar Runden hin und her. Die Freunde richteten sich auf, die Person rammte sie beiseite, bevor sie einen Gegenschlag ansetzen konnten und das brachte die Freunde schon ziemlich außer Puste.
Da fiel es Eimi plötzlich ein. Er erinnerte sich an den Kampf gegen Toni, der ständig nur ausgewichen war, ohne anzugreifen. Irgendwie gefiel ihm die Idee, dass diese Strategie so erfolgreich war und jemanden besiegen konnte.
„Shin, Tsuru, folgt mir!“, rief er den beiden zu. „Ich habe eine Idee!“
Ohne zu zögern, stellte sich Tsuru zu Eimi, Shin haderte jedoch noch für einen kurzen Augenblick. Erst Tsurus ernster Blick brachte ihn dazu, Eimi zu folgen. Dann rannten sie in Richtung einer Felswand und stellten sich davor.
„Auf mein Zeichen: Ausweichrolle!“, meinte Eimi nur und fing an, einen Hampelmann zu machen, um die Person zu provozieren. „Hey, hier sind wir, du Schnecke!“
Ein tiefes Grunzen signalisierte, dass die Person den Köder geschluckt hatte. Er scharrte mit den Füßen auf dem Boden wie ein Stier und rannte mit ganzer Kraft auf die drei zu.
Kurz bevor es so schien, als könnten sie nicht mehr ausweichen, rief Eimi: „Jetzt!“
Haarscharf konnten sie dem Angriff entfliehen, wodurch dieser Fleischberg seinen Kopf mit aller Gewalt in die Steinwand rammte. Das Beben, was daraufhin folgte, löste einige Felsbrocken aus der Wand, die hinabstürzten und die Person begruben. Shin, Tsuru und Eimi richteten sich auf, wagten es aber nicht, ein Geräusch zu machen. Sie warteten ab, ob sich der Felshaufen bewegte oder ob Eimis Plan aufgegangen war. Aber die Person zuckte nicht mehr. Es war still. Vorsichtig ging Tsuru auf den Felshaufen zu und untersuchte die Person.
„Sie scheint noch zu leben“, erklärte sie. „Aber sie ist ohnmächtig. Wir können uns später darum kümmern. Du hättest ruhig früher auf diese Idee kommen können, Eimi!“
„Keine Sorge“, meinte Shin und zückte sein Kommunikationsgerät und sprach einige Befehle hinein. „Es wird sich darum gekümmert.“
„Jetzt auf zu Pecos!“, forderte Tsuru; sie wartete keinen Moment und machte sich auf den Weg.
Es dauerte nicht lange, da kamen die drei an die Stelle, der zum Platz führte. Als Eimi hinter dem nächstgroßen Felsen die brennenden Fackeln und den Thron in der Mitte sah, war er zunächst erstaunt, dass der Platz komplett leer war.
Keine Menschenseele tummelte sich nun noch mehr an diesem Ort. Panisch suchte er die Umgebung ab, aber fand nichts und niemanden. Er wollte sich zu Tsuru und Shin umdrehen, aber die waren ebenfalls verschwunden.
„Tsuru!“, rief er, mit Händen als Trichter um seinen Mund, damit sein Ruf lauter wurde. „Shin! Wo seid ihr hin!?“
Er rannte wieder zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren, suchte dort auch ein Stück ab, aber dort war auch niemand zu finden.
„Hey, das ist nicht lustig!“
Es kam keine Antwort. Er ging zurück zum Platz und fing nun intensiver an, alles abzusuchen. Dort befanden sich Holzkisten, die jedoch mit einem Schloss abgesperrt waren. Auf den Tischen sah er medizinisches Werkzeug, das feinsäuberlich nebeneinander aufgereiht worden war. Wie als hätte er ein wichtiges Indiz gefunden, nahm er eine der Spritzen, die dort lagen, in die Hand und betrachtete sie genau. Der Glaszylinder hatte an beiden Enden eine metallische Ummantelung, in der sich das Flackern des Feuers spiegelte. Er sah es sich genauer an und sah hinter sich einen Schatten vorbeihuschen. Schnell drehte er sich um und wollte wissen, wer sich dort befand.
„Hallo?“, fragte er zögerlich. So langsam bekam er es mit der Angst zu tun. Wo konnten Tsuru und Shin nur hin verschwunden sein? Das musste irgend so ein Trick sein, um ihn hereinzulegen. Aber wozu? Wozu sollten sie ihn hereinlegen? Oder ging es wirklich nur darum, dass sie ihn von Tsuru trennten, weil sie die wichtige Person war?
Er sah sich weiter um und bemerkte im Augenwinkel, wie ein Schatten hinter dem Thron verschwand. Sofort lief er dem Schatten hinterher und sah aber hinter dem Thron nichts. Er lief noch zweimal darum herum, einfach nur, um sich sicherzugehen, aber dort war nichts.
„Wo seid ihr alle?“, fragte er, bekam aber natürlich keine Antwort darauf.
Dann fiel ihm auf einmal der Höhleneingang ein, der sich etwas weiter hinten in der Felswand befand. Die große Öffnung sah aus wie das tiefschwarze Maul eines Monsters. Neben dem merkwürdigen Gefühl in seiner Bauchgegend und den Kopfschmerzen, die nun einsetzten, fuhr eine Welle von Gänsehaut über seinen ganzen Körper. Seine Haut kitzelte dadurch intensiv. Er versuchte das Gefühl abzuschütteln, bevor er sich dem Höhleneingang näherte. Es herrschte Windstille, aber in der Nähe des Einganges schien die Luft eingesogen zu werden, wie als würde der Berg atmen. Ein herunterfallender Stein machte ein Geräusch, das sich echoartig wiederholte. Es kam tief aus der Höhle. Was, wenn sich der Kampf ins innere des Berges verlagert hatte? Konnte es sein, dass Shin und Tsuru schon längst hineingegangen waren, ohne auf ihn zu warten? Ihm blieb nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen.
Also nahm er all seinen Mut zusammen und stieg hinab in die Dunkelheit des Höhleneingangs. Es dauerte ein wenig, bis er sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte und etwas von dem Pfad, der darin war, erkennen konnte. Immer wieder rief er nach Tsuru und Shin, bekam jedoch nie eine Antwort. Als er dann aber den Punkt erreicht hatte, den Weg vor sich gut erkennen zu können, blendeten ihn einige Lichtpunkte, die in der Ferne des Tunnels in einem regelmäßigen Abstand voneinander leuchteten. Es mussten Lampen sein, die signalisierten, dass eine Kurve vor ihm lag. Er schluckte, weil er nicht wusste, was ihn erwarten würde und wollte nach seinem Schwert greifen. Es hing jedoch nicht mehr an der gleichen Stelle, wie es sonst hing. Es war verschwunden. Panisch suchte er den Boden um sich herum ab, als hätte er es aus Versehen auf den Boden fallen lassen. Dann realisierte er aber, als er nur nackten Steinboden spürte, dass er es sicherlich gehört hätte, wenn er es hätte fallen lassen.
Was sollte er jetzt machen? Er hatte weder Tsuru noch Shin an seiner Seite und sein Schwert war auch verschwunden. Machte es überhaupt Sinn, weiterzugehen? Aber er konnte seine Freundin nicht allein lassen. Er wollte sie nicht allein lassen. Er wollte dabei sein und seinen Beitrag leisten. Er wollte Tsuru beschützen und sich beweisen, dass er fähig war, Menschen zu beschützen, die ihm wichtig waren. Wie auch immer er das ohne Schwert bewerkstelligen sollte, er musste es einfach tun. Also nahm er all seinen Mut zusammen und lief unbewaffnet weiter in Richtung des Lichtes.
Ein plötzlich auftretendes Geräusch, das Eimi nicht definieren konnte, brachte ihn dazu, schneller zu laufen. Der Gang, in dem die Lichter schienen, war nun etwas enger, etwa zwei Personen breit und hoch. Dieser enge Schlauch führte Eimi eine Weile durch den Fels, während sein Gedankenkarussell nicht aufhörte, sich zu drehen.
Die Kurve erstreckte sich ziemlich lange. Nach seinem Gefühl war der Gang ein Kreis, aus dem er schon längst hätte herausfinden müssen. Eimi konnte auch nicht mehr einschätzen, wie lang er schon dem Gang folgte, deswegen wurde er etwas ungeduldig und lief schneller. Er war sich nicht sicher, aber auf einmal schien er den Schatten, den er vorher schon einige Male wahrgenommen hatte, vor sich laufen zu sehen.
„Hey!“, rief er und lief schneller. „Hey, warte!“
Der Schatten bewegte sich schneller und schien immer gerade so hinter der Kurve zu verschwinden, dass Eimi ihn nicht mehr sehen konnte. „Hey, warte doch!“
Was Eimi jedoch nicht bemerkte, war, dass die Lichter, die sich links und rechts in einem gleichmäßigen Abstand auf Höhe seiner Hüfte befanden, um den Gang zu beleuchten, allmählich schwächer und dunkler wurden. Er rannte und rannte und fand immer noch kein Ende des Ganges, bis er sich schließlich wieder in Dunkelheit befand. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, weiter zu laufen, bis er schmerzhaft das Ende des Ganges erreichte. Mit voller Geschwindigkeit stieß er auf eine Tür aus Metall, die er nicht hatte kommen sehen. Das Echo hallte lange nach, als sein Kopf auf die Tür aufprallte. Vor Schreck taumelte er etwas zurück und fiel auf seinen Hintern, während er sich seinen schmerzenden Kopf hielt.
„So eine Scheiße, was soll das!?“, ärgerte er sich und half sich selbst aufzustehen, indem er sich an die felsige Wand stützte. „Das ist nicht lustig!“
Eimi näherte sich der Tür und suchte nach der Türklinke, die schon ganz abgegriffen war. Er fühlte, wie sich der Lack von ihr löste und eine rostige Oberfläche darunter zum Vorschein kam. Er drückte die Klinke herunter und zu seiner Überraschung ließ sich die Tür leicht öffnen. Sie ging fast von allein auf, als wollte sie, dass Eimi auf jeden Fall hineinging.
Doch das, was er im Inneren des Raumes erblickte, ließ in demselben Moment, als die Tür sich hinter ihm automatisch schloss, das Blut in seinen Adern gefrieren.
Er befand sich wieder im Labor.
Konnte es möglich sein? War es einfach nur ein Labor, das genauso aussah, wie jenes, in welches sie damals eingedrungen waren? Er sah sich um und versicherte sich, dass es etwas geben musste, dass sich unterschied. Aber dort waren dieselben Operationstische, Vorhänge, Schränke, Werkzeuge und Betten wie damals.
Sein Herzschlag wurde rasant schneller, wodurch seine Atmung ebenfalls schneller und schwerer wurde. Ein Schweißteppich bildete sich in seinem Nacken und Rücken. Wie konnte er sich ausgerechnet jetzt wieder in diesem Labor befinden? War Vaidyam so perfektionistisch, dass er das Labor immer und immer wieder bauen ließ? Er wusste, dass Vaidyam mehrere Geheimlabore besaß, aber ausgerechnet hier?
Panisch suchte er das Labor weiter ab, um nach Anzeichen zu suchen, ob sich noch jemand hier befand. Der Schatten hatte ihn doch offensichtlich hierher gelockt. Aber warum?
Dann fiel ihm der Bereich des Labors ein, in dem er die Leiche der Frau aus dem Zug gefunden hatte. Vielleicht war jemand gefangen? Er musste sichergehen und helfen, wenn sich noch jemand hier befand. Eimi bemerkte jedoch, wie schwer seine Beine waren. Er musste seine ganze Kraft zusammennehmen, um weiterzugehen. Es war, als würde seine Angst davor zu scheitern ihn aufhalten. Da realisierte er, dass er keine Antwort darauf hatte, was er tun würde, wenn er wieder zu spät käme. Was, wenn das alles einfach keinen Zweck hatte? Wenn er wieder niemanden retten konnte? Er hatte nicht einmal mehr das Schwert dabei, das Tsuru für ihn hergestellt hatte. Wie sollte er jetzt etwas bewirken?
Dann erreichte er die Tür, die ihn in die große Halle führen sollte, die in seiner Erinnerung gefüllt war mit Betten voller Leichen und Glaszylindern. Langsam legte er seine Hand auf die Klinke und noch bevor er sie berührte, öffnete sich diese Tür wie von selbst. Es war ein weiteres Zeichen, dass er hineintreten sollte, um sich dem zu stellen, wovor er wohl am meisten Angst hatte. Eimi schluckte trocken; vor Angst hatte er keinen Speichel mehr im Mund. Seine Befürchtung bestätigte sich, als er hindurch ging und sich tatsächlich in der großen Halle wiederfand. Die Glaszylinder mit der orangefarbenen Flüssigkeit beinhalteten die gleichen Fleischklumpen wie damals. Das konnte nicht sein. Es konnte einfach nicht sein. Eimi wollte es nicht wahrhaben. Die Panik stieg in ihm hoch und sofort rannte er zu dem Bett, in dem er die Frau aus dem Zug vermutete. Wie konnte es sein, dass sich dieses Labor genau hier befand, wo es doch damals verbrannt war? Als er das Bett erreichte, lag dieselbe Leiche darin, die er schon einmal gesehen hatte. Sein Körper zitterte und bebte, als er das Gesicht der Toten sah.
„Nicht schon wieder“, sprach er zu sich selbst. „Ich bin schon wieder zu spät. Ich schaff es nicht…“
„… ich schaff es nicht, zu beschützen …“, sprach plötzlich eine fremde Stimme, die aus dem Nirgendwo zu ihm sprach. Eimi weinte und nahm die Stimme zunächst nicht wahr, bis sie allmählich lauter wurde.
„… ich schaffe es nicht, zu beschützen …“, wiederholte die Stimme.
Dann sah Eimi sich verwirrt um, weil er erwartet hatte, dass der Schatten in der Nähe war und zu ihm sprach. Irgendetwas Merkwürdiges ging hier vor sich und Eimi wusste nicht, wieso. War es ein Traum?
Dann griff etwas nach seiner Hand. Er schreckte zusammen, weil er es nicht erwartet hatte. Als er sich zurück zum Bett wandte, sah er, wie Vaidyam aus dem aufgeplatzten Mutterleib der Leiche herauskroch und nach ihm griff. Er erkannte das mit Schleim verschmierte Gesicht seines Feindes und schrie, konnte sich jedoch nicht von seinem Griff lösen. Die Angst schnürte ihm den Hals zu und das Einzige, was sich nun in seinen Gedanken breitmachte, war der Wunsch nach Flucht.
Irgendetwas war hier falsch.
„… ich schaffe es nicht, zu beschützen …“, sprach nun Vaidyam mit Eimis Stimme und wiederholte die Worte wie in einem Mantra. Dann blähte sich Vaidyam auf und sein Aussehen verwandelte sich zu einem riesigen Fleischklumpen. Die Stellen, die sich am schnellsten aufblähten, pochten im Rhythmus, der Eimis Herzschlag merkwürdig ähnlich war. Die Haut glänzte vor Schleim, während sie sich auf unmenschliche Weisen bewegte. Eimi sah sich um, um nach etwas zu suchen, was ihm half.
„Das ist nur ein Traum, ein blöder Traum!“, sprach er immer wieder zu sich selbst, um irgendwie die Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Er versuchte sich wegzuziehen, aber das Ding, das einmal Vaidyam gewesen war, hielt fest an seinem Arm.
Er drehte sich wieder weg und suchte den Raum ab, nach etwas, das ihm helfen konnte. In einer dunklen Ecke zu seiner rechten Seite stand eine Person im Schatten. Erst beim zweiten Blick darauf erkannte er das Mädchen mit den drei Augen, das Vaidyam bei sich hatte.
„Du bist das!“, rief er zu ihr, um ihre Aufmerksamkeit zu erreichen. „Ich weiß, wer du bist!“
Das Mädchen reagierte nicht. Dafür starrten ihre drei Augen direkt auf Eimi. Die Luft um sie herum schien merkwürdig zu vibrieren.
„Brauchst du Hilfe?“, fragte er, ohne darüber nachzudenken. „Ich helfe dir hier raus!“
Das Mädchen reagierte jedoch nicht.
„Kannst du mir helfen?“, fragte Eimi, als die schleimige Fleischmasse sich zu seinem Ellbogen hochgearbeitet hatte. Eimi versuchte, sich mit einem Bein von dem Bett wegzudrücken, um sich irgendwie loszureißen; es klappte jedoch nicht.
„Ich brauche echt Hilfe hier, dann kann ich dir den Weg nach draußen zeigen“, meinte er in einem viel freundlicheren Ton. Dass sich noch jemand mit ihm hier befand, half ihm, seine Angst unter Kontrolle zu kriegen.
„Warum bist du mit Vaidyam zusammen unterwegs?“, fragte Eimi, der herausfinden wollte, was sie hier überhaupt machte. Das Vibrieren um sie herum schien nicht nachzulassen. „Siehst du nicht, was für grausame Sachen er hier macht? Warum hilfst du ihm?“
Das Mädchen reagierte immer noch nicht.
„Warte …“, meinte Eimi und dachte nach. Er war sich sicher, dass er ihren Namen schon gehört hatte. „Ich weiß, wie du heißt. Du bist Mirna, richtig?“
Nun nickte das Mädchen. Das fand Eimi gut; sie reagierte auf ihn.
„Ich kann dich beschützen!“, schlug Eimi vor. „Ich kann dich vor Vaidyam beschützen!“
Nach diesen Worten arbeitete sich das Fleischmonster schon zu seinem Oberarm durch. Mit seiner anderen Hand schlug er mehrmals auf den Bereich, der wie ein Maul war, jedoch erreichte er dadurch gar nichts. Es schien nur schlimmer zu werden.
„Lass uns doch wenigstens hier herausgehen, dieses Labor ist zu gruselig“, meinte Eimi jetzt und sah sich um, ob nicht doch etwas herumlag, das ihm helfen könnte. Doch er fand einfach nichts. „Ich möchte aus diesem Albtraum fliehen, du nicht auch?“
Nun streckte Mirna ihre Hände aus und daraufhin schien das Schwert zu erscheinen, das Tsuru und Ea für ihn gemacht hatten.
„Warte, du willst, dass wir aus diesem Albtraum fliehen? Ich kann dich mit dem Schwert beschützen!“
Nachdem er diese Worte gesprochen hatte, wurde das Schwert wieder transparenter.
„Nein, nein“, verzweifelte Eimi langsam; das Monster hatte nun fast schon seine Schulter verschluckt. Der Schweiß tropfte ihm von Nasenspitze und Kinn. Er schnaufte.
„Ich brauche deine Hilfe, wirklich.“ Das Schwert wurde wieder sichtbarer. „Ich brauche wirklich Hilfe, mich aus diesem Albtraum zu befreien. Ich schaff es nicht allein.“
Das Schwert war nun wieder sichtbar.
„Ich …“, gestand sich Eimi zögerlich, „ich schaffe das alles nicht allein. Ich kann niemanden allein beschützen. Ich brauche die anderen.“
Nun machte Mirna einen Schritt auf ihn zu.
„Du scheinst auch allein zu sein. Spricht keiner mit dir? Spricht Vaidyam mit dir? Brauchst du jemanden, mit dem du nicht allein bist?“
Sie nickte.
„Warum hilfst du mir nicht?“, wunderte sich Eimi.
Dann verschwand das Schwert wieder und sie ließ ihre Hände wieder sinken. Ihr Gesichtsausdruck schien auf einmal so schmerzvoll und leidend zu sein. Auf einmal breitete sich ein Gedanke in Eimis Innerem aus, der sich in seiner Brust manifestierte und wie ein warmes, weißes Licht war, das ihn langsam ausfüllte. „Ich schaffe nichts allein. Aber ich muss mir selbst erst helfen, das zu verstehen, bevor ich jemanden retten kann.“
Daraufhin fühlte Eimi etwas Warmes in seiner freien Hand. Das Monster hatte sich mittlerweile über seine Brust bis zu seinem Hals gestülpt. Er hob seine freie Hand, hielt auf einmal das Schwert darin und stach damit auf das Monster ein. Als die Klinge auf die Masse eindrang, strömte Blut heraus. Er verstand nun, dass das Schwert eine mächtige, gefährliche Waffe war. Endlich befreit, ging er auf Mirna zu und reichte ihr die Hand, die vor Blut nur triefte.
„Was ist das hier für ein Albtraum?“, fragte er und bevor sie seine Hand nahm, zeigte sie mit der anderen auf ihr drittes Auge.
Als sich ihre Hände berührten, blitzte Dunkelheit vor Eimis Augen auf und er befand sich wieder auf dem Platz vor der Höhle. In dessen Mitte befand sich der Thron, auf dem Vaidyam lachend saß. Schutztruppler kämpften ringsherum gegen massige Monster an Leuten, verstärkt durch Vaidyams Drogen. Neben Eimi befanden sich Ea, Tsuru, Shin, Khamal und Pecos auf Knien. Mirna stand neben Vaidyam, der auf eine unfassbar ekelhafte Art ihren Kopf streichelte.
Das alles musste ein Albtraum gewesen sein. War er von Mirna ausgegangen? Auch um sie herum schien die Luft merkwürdig zu vibrieren.